Suchergebnis
vom: 16.04.2020
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und Bundesministerium für Bildung und Forschung
BAnz AT 18.06.2020 B2
Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie
Bundesministerium
für Bildung und Forschung
Bekanntmachung
der Verordnungen über
die Berufsausbildung in den IT-Berufen
nebst Rahmenlehrplänen
Nachstehend werden
- a)
-
die Verordnungen über die Berufsausbildung in den IT-Berufen vom 28. Februar 2020 (BGBl. I S. 250), nachrichtlich veröffentlicht,
- b)
-
die Rahmenlehrpläne für die Ausbildungsberufe Fachinformatiker und Fachinformatikerin; IT-System-Elektroniker und IT-System-Elektronikerin sowie Kaufmann für IT-System-Management und Kauffrau für IT-System-Management; Kaufmann für Digitalisierungsmanagement und Kauffrau für Digitalisierungsmanagement – Beschluss der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland vom 13. Dezember 2019 – bekannt gegeben.
Die Verordnungen und die Rahmenlehrpläne sind nach dem zwischen Bund und Ländern auf der Grundlage des Gemeinsamen Ergebnisprotokolls vom 30. Mai 1972 vereinbarten Verfahren miteinander abgestimmt worden.
Zusammen mit den Verordnungen und den Rahmenlehrplänen wurden Zeugniserläuterungen in deutscher, englischer und französischer Sprache erarbeitet und mit den Spitzenorganisationen der an der betrieblichen Berufsausbildung Beteiligten abgestimmt. Diese werden zu einem späteren Zeitpunkt auf der Internetseite des Bundesinstituts für Berufsbildung (http://www2.bibb.de/tools/aab/aabzeliste_de.php) zugänglich gemacht werden. Den zuständigen Stellen wird empfohlen, die Zeugniserläuterungen als Anlage zum Abschlusszeugnis den Absolventen auszuhändigen.
Die Listen der Entsprechungen zwischen Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrplänen ist im Informationssystem Aus- und Weiterbildung (A.WE.B) des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) veröffentlicht unter http://www.bibb.de/berufssuche.
VII B 4 – 73004/002
Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie
V. Werker
Bundesministerium
für Bildung und Forschung
Angelika Block-Meyer
Verordnung
über die Berufsausbildung zum Fachinformatiker und zur Fachinformatikerin
(Fachinformatikerausbildungsverordnung – FIAusbV)
*
Auf Grund des § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes, der zuletzt durch Artikel 436 Nummer 1 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung:
Inhaltsübersicht
Gegenstand, Dauer und Gliederung der Berufsausbildung
| § 1 | Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes |
| § 2 | Dauer der Berufsausbildung |
| § 3 | Gegenstand der Berufsausbildung und Ausbildungsrahmenplan |
| § 4 | Struktur der Berufsausbildung, Ausbildungsberufsbild |
| § 5 | Einsatzgebiet |
| § 6 | Ausbildungsplan |
Abschlussprüfung
Allgemeines
| § 7 | Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt |
Teil 1 der Abschlussprüfung
| § 8 | Inhalt von Teil 1 |
| § 9 | Prüfungsbereich von Teil 1 |
Teil 2 der Abschlussprüfung in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung
| § 10 | Inhalt von Teil 2 |
| § 11 | Prüfungsbereiche von Teil 2 |
| § 12 | Prüfungsbereich Planen und Umsetzen eines Softwareprojektes |
| § 13 | Prüfungsbereich Planen eines Softwareproduktes |
| § 14 | Prüfungsbereich Entwicklung und Umsetzung von Algorithmen |
| § 15 | Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde |
| § 16 | Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprüfung |
| § 17 | Mündliche Ergänzungsprüfung |
Teil 2 der Abschlussprüfung in der Fachrichtung Systemintegration
| § 18 | Inhalt von Teil 2 |
| § 19 | Prüfungsbereiche von Teil 2 |
| § 20 | Prüfungsbereich Planen und Umsetzen eines Projektes der Systemintegration |
| § 21 | Prüfungsbereich Konzeption und Administration von IT-Systemen |
| § 22 | Prüfungsbereich Analyse und Entwicklung von Netzwerken |
| § 23 | Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde |
| § 24 | Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprüfung |
| § 25 | Mündliche Ergänzungsprüfung |
Teil 2 der Abschlussprüfung in der Fachrichtung Daten- und Prozessanalyse
| § 26 | Inhalt von Teil 2 |
| § 27 | Prüfungsbereiche von Teil 2 |
| § 28 | Prüfungsbereich Planen und Durchführen eines Projektes der Datenanalyse |
| § 29 | Prüfungsbereich Durchführen einer Prozessanalyse |
| § 30 | Prüfungsbereich Sicherstellen der Datenqualität |
| § 31 | Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde |
| § 32 | Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprüfung |
| § 33 | Mündliche Ergänzungsprüfung |
Teil 2 der Abschlussprüfung in der Fachrichtung Digitale Vernetzung
| § 34 | Inhalt von Teil 2 |
| § 35 | Prüfungsbereiche von Teil 2 |
| § 36 | Prüfungsbereich Planen und Umsetzen eines Projektes der digitalen Vernetzung |
| § 37 | Prüfungsbereich Diagnose und Störungsbeseitigung in vernetzten Systemen |
| § 38 | Prüfungsbereich Betrieb und Erweiterung von vernetzten Systemen |
| § 39 | Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde |
| § 40 | Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprüfung |
| § 41 | Mündliche Ergänzungsprüfung |
Schlussvorschriften
| § 42 | Bestehende Berufsausbildungsverhältnisse |
| § 43 | Inkrafttreten, Außerkrafttreten |
| Anlage: | Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Fachinformatiker und zur Fachinformatikerin |
Gegenstand, Dauer und Gliederung der Berufsausbildung
Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes
Der Ausbildungsberuf des Fachinformatikers und der Fachinformatikerin wird nach § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes staatlich anerkannt.
Dauer der Berufsausbildung
Die Berufsausbildung dauert drei Jahre.
Gegenstand der Berufsausbildung und Ausbildungsrahmenplan
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die im Ausbildungsrahmenplan (Anlage) genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten. Von der Organisation der Berufsausbildung, wie sie im Ausbildungsrahmenplan vorgegeben ist, darf abgewichen werden, wenn und soweit betriebspraktische Besonderheiten oder Gründe, die in der Person des oder der Auszubildenden liegen, die Abweichung erfordern.
Die im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sollen so vermittelt werden, dass die Auszubildenden die berufliche Handlungsfähigkeit nach § 1 Absatz 3 des Berufsbildungsgesetzes erlangen. Die berufliche Handlungsfähigkeit schließt insbesondere selbständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren ein.
Struktur der Berufsausbildung, Ausbildungsberufsbild
Die Berufsausbildung gliedert sich in:
- 1.
-
fachrichtungsübergreifende berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten,
- 2.
-
berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung
- a)
-
Anwendungsentwicklung,
- b)
-
Systemintegration,
- c)
-
Daten- und Prozessanalyse und
- d)
-
Digitale Vernetzung sowie
- 3.
-
fachrichtungsübergreifende, integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.
Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind in Berufsbildpositionen als Teil des Ausbildungsberufsbildes gebündelt.
Die Berufsbildpositionen der fachrichtungsübergreifenden berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
- 1.
-
Planen, Vorbereiten und Durchführen von Arbeitsaufgaben in Abstimmung mit den kundenspezifischen Geschäfts- und Leistungsprozessen,
- 2.
-
Informieren und Beraten von Kunden und Kundinnen,
- 3.
-
Beurteilen marktgängiger IT-Systeme und kundenspezifischer Lösungen,
- 4.
-
Entwickeln, Erstellen und Betreuen von IT-Lösungen,
- 5.
-
Durchführen und Dokumentieren von qualitätssichernden Maßnahmen,
- 6.
-
Umsetzen, Integrieren und Prüfen von Maßnahmen zur IT-Sicherheit und zum Datenschutz,
- 7.
-
Erbringen der Leistungen und Auftragsabschluss,
- 8.
-
Betreiben von IT-Systemen,
- 9.
-
Inbetriebnehmen von Speicherlösungen und
- 10.
-
Programmieren von Softwarelösungen.
Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung sind:
- 1.
-
Konzipieren und Umsetzen von kundenspezifischen Softwareanwendungen und
- 2.
-
Sicherstellen der Qualität von Softwareanwendungen.
Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung Systemintegration sind:
- 1.
-
Konzipieren und Realisieren von IT-Systemen,
- 2.
-
Installieren und Konfigurieren von Netzwerken und
- 3.
-
Administrieren von IT-Systemen.
Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung Daten- und Prozessanalyse sind:
- 1.
-
Analysieren von Arbeits- und Geschäftsprozessen,
- 2.
-
Analysieren von Datenquellen und Bereitstellen von Daten,
- 3.
-
Nutzen der Daten zur Optimierung von Arbeits- und Geschäftsprozessen sowie zur Optimierung digitaler Geschäftsmodelle und
- 4.
-
Umsetzen des Datenschutzes und der Schutzziele der Datensicherheit.
Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung Digitale Vernetzung sind:
- 1.
-
Analysieren und Planen von Systemen zur Vernetzung von Prozessen und Produkten,
- 2.
-
Errichten, Ändern und Prüfen von vernetzten Systemen und
- 3.
-
Betreiben von vernetzten Systemen und Sicherstellen der Systemverfügbarkeit.
Die Berufsbildpositionen der integrativ zu vermittelnden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
- 1.
-
Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht,
- 2.
-
Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes,
- 3.
-
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,
- 4.
-
Umweltschutz und
- 5.
-
vernetztes Zusammenarbeiten unter Nutzung digitaler Medien.
Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der in Absatz 2 Nummer 1 bis 7 genannten Berufsbildpositionen sind im Bereich der IT-Berufe berufsübergreifend und werden in gleicher Weise auch in den folgenden Berufsausbildungen vermittelt:
- 1.
-
in der Berufsausbildung zum Kaufmann für Digitalisierungsmanagement und zur Kauffrau für Digitalisierungsmanagement nach der Digitalisierungsmanagement-Kaufleute-Ausbildungsverordnung vom 28. Februar 2020 (BGBl. I S. 290),
- 2.
-
in der Berufsausbildung zum IT-System-Elektroniker und zur IT-System-Elektronikerin nach der IT-System-Elektroniker-Ausbildungsverordnung vom 28. Februar 2020 (BGBl. I S. 268) und
- 3.
-
in der Berufsausbildung zum Kaufmann für IT-System-Management und zur Kauffrau für IT-System-Management nach der IT-System-Management-Kaufleute-Ausbildungsverordnung vom 28. Februar 2020 (BGBl. I S. 280).
Einsatzgebiet
In der Fachrichtung Anwendungsentwicklung sind die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der Berufsbildpositionen nach § 4 Absatz 2, 3 und 7 in einem der folgenden Einsatzgebiete zu vermitteln:
- 1.
-
kaufmännische Systeme,
- 2.
-
technische Systeme,
- 3.
-
Expertensysteme,
- 4.
-
mathematisch-wissenschaftliche Systeme und
- 5.
-
Multimedia-Systeme.
In der Fachrichtung Systemintegration sind die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der Berufsbildpositionen nach § 4 Absatz 2, 4 und 7 in einem der folgenden Einsatzgebiete zu vermitteln:
- 1.
-
Rechenzentren,
- 2.
-
Netzwerke,
- 3.
-
Client-Server-Architekturen,
- 4.
-
Festnetze und
- 5.
-
Funknetze.
In der Fachrichtung Daten- und Prozessanalyse sind die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der Berufsbildpositionen nach § 4 Absatz 2, 5 und 7 in einem der folgenden Einsatzgebiete zu vermitteln:
- 1.
-
Prozessoptimierung,
- 2.
-
Prozessmodellierung,
- 3.
-
Qualitätssicherung,
- 4.
-
Medienanalyse und
- 5.
-
Suchdienste.
In der Fachrichtung Digitale Vernetzung sind die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der Berufsbildpositionen nach § 4 Absatz 2, 6 und 7 in einem der folgenden Einsatzgebiete zu vermitteln:
- 1.
-
produktionstechnische Systeme,
- 2.
-
prozesstechnische Systeme,
- 3.
-
autonome Assistenz- und Transportsysteme und
- 4.
-
Logistiksysteme.
Der Ausbildungsbetrieb legt fest, in welchem Einsatzgebiet die Vermittlung erfolgt. Der Ausbildungsbetrieb darf mit Zustimmung der zuständigen Stelle jedoch auch ein anderes Einsatzgebiet festlegen, wenn in diesem Einsatzgebiet die gleichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt werden.
Ausbildungsplan
Die Ausbildenden haben spätestens zu Beginn der Ausbildung auf der Grundlage des Ausbildungsrahmenplans für jeden Auszubildenden und für jede Auszubildende einen Ausbildungsplan zu erstellen.
Abschlussprüfung
Allgemeines
Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt
Die Abschlussprüfung besteht aus den Teilen 1 und 2.
Teil 1 findet im vierten Ausbildungshalbjahr statt, Teil 2 am Ende der Berufsausbildung. Den jeweiligen Zeitpunkt legt die zuständige Stelle fest.
Teil 1
der Abschlussprüfung
Inhalt von Teil 1
Teil 1 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf
- 1.
-
die im Ausbildungsrahmenplan für die ersten 18 Monate genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der Berufsbildpositionen nach § 4 Absatz 2 Nummer 1 bis 7 sowie
- 2.
-
den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.
Prüfungsbereich von Teil 1
Teil 1 der Abschlussprüfung findet im Prüfungsbereich Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes statt.
Im Prüfungsbereich Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
- 1.
-
Kundenbedarfe zielgruppengerecht zu ermitteln,
- 2.
-
Hard- und Software auszuwählen und ihre Beschaffung einzuleiten,
- 3.
-
einen IT-Arbeitsplatz zu konfigurieren und zu testen und dabei die Bestimmungen und die betrieblichen Vorgaben zum Datenschutz, zur IT-Sicherheit und zur Qualitätssicherung einzuhalten,
- 4.
-
Kunden und Kundinnen in die Nutzung des Arbeitsplatzes einzuweisen und
- 5.
-
die Leistungserbringung zu kontrollieren und zu protokollieren.
Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.
Teil 2
der Abschlussprüfung in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung
Inhalt von Teil 2
Teil 2 der Abschlussprüfung erstreckt sich in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung auf
- 1.
-
die im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie
- 2.
-
den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.
In Teil 2 der Abschlussprüfung sollen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die bereits Gegenstand von Teil 1 der Abschlussprüfung waren, nur insoweit einbezogen werden, als es für die Feststellung der beruflichen Handlungsfähigkeit erforderlich ist.
Prüfungsbereiche von Teil 2
Teil 2 der Abschlussprüfung findet in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung in den folgenden Prüfungsbereichen statt:
- 1.
-
Planen und Umsetzen eines Softwareprojektes,
- 2.
-
Planen eines Softwareproduktes,
- 3.
-
Entwicklung und Umsetzung von Algorithmen sowie
- 4.
-
Wirtschafts- und Sozialkunde.
Prüfungsbereich
Planen und Umsetzen eines Softwareprojektes
Im Prüfungsbereich Planen und Umsetzen eines Softwareprojektes besteht die Prüfung aus zwei Teilen.
Im ersten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
- 1.
-
kundenspezifische Anforderungen zu analysieren,
- 2.
-
eine Projektplanung durchzuführen,
- 3.
-
eine wirtschaftliche Betrachtung des Projektes vorzunehmen,
- 4.
-
eine Softwareanwendung zu erstellen oder anzupassen,
- 5.
-
die erstellte oder angepasste Softwareanwendung zu testen und ihre Einführung vorzubereiten und
- 6.
-
die Planung und Durchführung des Projektes anforderungsgerecht zu dokumentieren.
Der Prüfling hat eine betriebliche Projektarbeit durchzuführen und mit praxisbezogenen Unterlagen zu dokumentieren. Vor der Durchführung der betrieblichen Projektarbeit hat er dem Prüfungsausschuss eine Projektbeschreibung zur Genehmigung vorzulegen. In der Projektbeschreibung hat er die Ausgangssituation und das Projektziel zu beschreiben und eine Zeitplanung aufzustellen. Die Prüfungszeit beträgt für die betriebliche Projektarbeit und für die Dokumentation mit praxisbezogenen Unterlagen höchstens 80 Stunden.
Im zweiten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
- 1.
-
die Arbeitsergebnisse adressatengerecht zu präsentieren und
- 2.
-
seine Vorgehensweise bei der Durchführung der betrieblichen Projektarbeit zu begründen.
Der Prüfling hat die betriebliche Projektarbeit zu präsentieren. Nach der Präsentation wird mit ihm ein Fachgespräch über die betriebliche Projektarbeit und die präsentierten Arbeitsergebnisse geführt. Die Prüfungszeit beträgt insgesamt höchstens 30 Minuten. Die Präsentation soll höchstens 15 Minuten dauern.
Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind die Bewertungen wie folgt zu gewichten:
- 1.
-
die Bewertung für den ersten Teil mit 50 Prozent und
- 2.
-
die Bewertung für den zweiten Teil mit 50 Prozent.
Prüfungsbereich
Planen eines Softwareproduktes
Im Prüfungsbereich Planen eines Softwareproduktes hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
- 1.
-
Entwicklungsumgebungen und -bibliotheken auszuwählen und einzusetzen,
- 2.
-
Programmspezifikationen anwendungsgerecht festzulegen,
- 3.
-
Bedienoberflächen funktionsgerecht und ergonomisch zu konzipieren sowie
- 4.
-
Maßnahmen zur Qualitätskontrolle zu planen und durchzuführen.
Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.
Prüfungsbereich
Entwicklung und Umsetzung von Algorithmen
Im Prüfungsbereich Entwicklung und Umsetzung von Algorithmen hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
- 1.
-
einen Programmcode zu interpretieren und eine Lösung in einer Programmiersprache zu erstellen,
- 2.
-
Algorithmen in eine Programmierlogik zu übertragen und grafisch darzustellen,
- 3.
-
Testszenarien auszuwählen und Testdaten zu generieren sowie
- 4.
-
Abfragen zur Gewinnung und Manipulation von Daten zu erstellen.
Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.
Prüfungsbereich
Wirtschafts- und Sozialkunde
Im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist, allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu beurteilen.
Die Prüfungsaufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.
Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprüfung
Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche sind in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung wie folgt zu gewichten:
- 1.
-
Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes mit20 Prozent,
- 2.
-
Planen und Umsetzen eines Softwareprojektes mit50 Prozent,
- 3.
-
Planen eines Softwareproduktes mit10 Prozent,
- 4.
-
Entwicklung und Umsetzung von Algorithmen mit10 Prozent sowie
- 5.
-
Wirtschafts- und Sozialkunde mit10 Prozent.
Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen – auch unter Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 17 – wie folgt bewertet worden sind:
- 1.
-
im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
- 2.
-
im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
- 3.
-
in mindestens drei Prüfungsbereichen von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“ und
- 4.
-
in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenügend“.
Mündliche Ergänzungsprüfung
Der Prüfling kann in einem Prüfungsbereich eine mündliche Ergänzungsprüfung beantragen.
Dem Antrag ist stattzugeben,
- 1.
-
wenn er für einen der folgenden Prüfungsbereiche gestellt worden ist:
- a)
-
Planen eines Softwareproduktes,
- b)
-
Entwicklung und Umsetzung von Algorithmen oder
- c)
-
Wirtschafts- und Sozialkunde,
- 2.
-
wenn der benannte Prüfungsbereich schlechter als mit „ausreichend“ bewertet worden ist und
- 3.
-
wenn die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen der Abschlussprüfung den Ausschlag geben kann.
Die mündliche Ergänzungsprüfung darf nur in einem einzigen Prüfungsbereich durchgeführt werden.
Die mündliche Ergänzungsprüfung soll 15 Minuten dauern.
Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2:1 zu gewichten.
Teil 2
der Abschlussprüfung in der Fachrichtung Systemintegration
Inhalt von Teil 2
Teil 2 der Abschlussprüfung erstreckt sich in der Fachrichtung Systemintegration auf
- 1.
-
die im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie
- 2.
-
den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.
In Teil 2 der Abschlussprüfung sollen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die bereits Gegenstand von Teil 1 der Abschlussprüfung waren, nur insoweit einbezogen werden, als es für die Feststellung der beruflichen Handlungsfähigkeit erforderlich ist.
Prüfungsbereiche von Teil 2
Teil 2 der Abschlussprüfung findet in der Fachrichtung Systemintegration in den folgenden Prüfungsbereichen statt:
- 1.
-
Planen und Umsetzen eines Projektes der Systemintegration,
- 2.
-
Konzeption und Administration von IT-Systemen,
- 3.
-
Analyse und Entwicklung von Netzwerken sowie
- 4.
-
Wirtschafts- und Sozialkunde.
Prüfungsbereich
Planen und Umsetzen eines Projektes der Systemintegration
Im Prüfungsbereich Planen und Umsetzen eines Projektes der Systemintegration besteht die Prüfung aus zwei Teilen.
Im ersten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
- 1.
-
auftragsbezogene Anforderungen zu analysieren,
- 2.
-
Lösungsalternativen unter Berücksichtigung technischer, wirtschaftlicher und qualitativer Aspekte vorzuschlagen,
- 3.
-
Systemänderungen und -erweiterungen durchzuführen und zu übergeben,
- 4.
-
IT-Systeme einzuführen und zu pflegen,
- 5.
-
Schwachstellen von IT-Systemen zu analysieren und Schutzmaßnahmen vorzuschlagen und umzusetzen sowie
- 6.
-
Projekte der Systemintegration anforderungsgerecht zu dokumentieren.
Der Prüfling hat eine betriebliche Projektarbeit durchzuführen und mit praxisbezogenen Unterlagen zu dokumentieren. Vor der Durchführung der Projektarbeit hat er dem Prüfungsausschuss eine Projektbeschreibung zur Genehmigung vorzulegen. In der Projektbeschreibung hat er die Ausgangssituation und das Projektziel zu beschreiben und eine Zeitplanung aufzustellen. Die Prüfungszeit beträgt für die betriebliche Projektarbeit und für die Dokumentation mit praxisbezogenen Unterlagen höchstens 40 Stunden.
Im zweiten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
- 1.
-
die Arbeitsergebnisse adressatengerecht zu präsentieren und
- 2.
-
seine Vorgehensweise bei der Durchführung der betrieblichen Projektarbeit zu begründen.
Der Prüfling hat die betriebliche Projektarbeit zu präsentieren. Nach der Präsentation wird mit ihm ein Fachgespräch über die betriebliche Projektarbeit und die präsentierten Arbeitsergebnisse geführt. Die Prüfungszeit beträgt insgesamt höchstens 30 Minuten. Die Präsentation soll höchstens 15 Minuten dauern.
Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind die Bewertungen wie folgt zu gewichten:
- 1.
-
die Bewertung für den ersten Teil mit 50 Prozent und
- 2.
-
die Bewertung für den zweiten Teil mit 50 Prozent.
Prüfungsbereich
Konzeption und Administration von IT-Systemen
Im Prüfungsbereich Konzeption und Administration von IT-Systemen hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
- 1.
-
IT-Systeme für unterschiedliche Anforderungen zu planen und zu konfigurieren,
- 2.
-
IT-Systeme zu administrieren und zu betreiben,
- 3.
-
Speicherlösungen zu integrieren und zu verwalten und
- 4.
-
Programme zur automatisierten Systemverwaltung zu erstellen.
Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.
Prüfungsbereich
Analyse und Entwicklung von Netzwerken
Im Prüfungsbereich Analyse und Entwicklung von Netzwerken hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
- 1.
-
Netzwerkprotokolle anwendungsbezogen auszuwählen und einzusetzen,
- 2.
-
Netzwerkkomponenten bedarfsgerecht auszuwählen und zu konfigurieren,
- 3.
-
die IT-Sicherheit in Netzwerken sicherzustellen und
- 4.
-
den Betrieb und die Verfügbarkeit von Netzwerken zu überwachen und zu gewährleisten.
Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.
Prüfungsbereich
Wirtschafts- und Sozialkunde
Im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist, allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu beurteilen.
Die Prüfungsaufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.
Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprüfung
Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche sind in der Fachrichtung Systemintegration wie folgt zu gewichten:
- 1.
-
Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes mit20 Prozent,
- 2.
-
Planen und Umsetzen eines Projektes der Systemintegration mit50 Prozent,
- 3.
-
Konzeption und Administration von IT-Systemen mit10 Prozent,
- 4.
-
Analyse und Entwicklung von Netzwerken mit10 Prozent sowie
- 5.
-
Wirtschafts- und Sozialkunde mit10 Prozent.
Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen – auch unter Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 25 – wie folgt bewertet worden sind:
- 1.
-
im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
- 2.
-
im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
- 3.
-
in mindestens drei Prüfungsbereichen von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“ und
- 4.
-
in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenügend“.
Mündliche Ergänzungsprüfung
Der Prüfling kann in einem Prüfungsbereich eine mündliche Ergänzungsprüfung beantragen.
Dem Antrag ist stattzugeben,
- 1.
-
wenn er für einen der folgenden Prüfungsbereiche gestellt worden ist:
- a)
-
Konzeption und Administration von IT-Systemen,
- b)
-
Analyse und Entwicklung von Netzwerken oder
- c)
-
Wirtschafts- und Sozialkunde,
- 2.
-
wenn der benannte Prüfungsbereich schlechter als mit „ausreichend“ bewertet worden ist und
- 3.
-
wenn die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen der Abschlussprüfung den Ausschlag geben kann.
Die mündliche Ergänzungsprüfung darf nur in einem einzigen Prüfungsbereich durchgeführt werden.
Die mündliche Ergänzungsprüfung soll 15 Minuten dauern.
Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2:1 zu gewichten.
Teil 2
der Abschlussprüfung in der Fachrichtung Daten- und Prozessanalyse
Inhalt von Teil 2
Teil 2 der Abschlussprüfung erstreckt sich in der Fachrichtung Daten- und Prozessanalyse auf
- 1.
-
die im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie
- 2.
-
den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.
In Teil 2 der Abschlussprüfung sollen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die bereits Gegenstand von Teil 1 der Abschlussprüfung waren, nur insoweit einbezogen werden, als es für die Feststellung der beruflichen Handlungsfähigkeit erforderlich ist.
Prüfungsbereiche von Teil 2
Teil 2 der Abschlussprüfung findet in der Fachrichtung Daten- und Prozessanalyse in den folgenden Prüfungsbereichen statt:
- 1.
-
Planen und Durchführen eines Projektes der Datenanalyse,
- 2.
-
Durchführen einer Prozessanalyse,
- 3.
-
Sicherstellen der Datenqualität sowie
- 4.
-
Wirtschafts- und Sozialkunde.
Prüfungsbereich
Planen und Durchführen eines Projektes der Datenanalyse
Im Prüfungsbereich Planen und Durchführen eines Projektes der Datenanalyse besteht die Prüfung aus zwei Teilen.
Im ersten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
- 1.
-
kundenspezifische Anforderungen zu analysieren,
- 2.
-
die Projektumsetzung zu planen und dabei die zugehörigen betrieblichen Prozesse zu berücksichtigen und die bestehenden Regeln einzuhalten,
- 3.
-
Daten zu identifizieren, zu klassifizieren, zu modellieren, unter Nutzung mathematischer Vorhersagemodelle und statistischer Verfahren zu analysieren und die Datenqualität sicherzustellen,
- 4.
-
die Analyseergebnisse aufzubereiten und Optimierungsmöglichkeiten aufzuzeigen sowie
- 5.
-
Projekte der Datenanalyse anforderungsgerecht zu dokumentieren.
Der Prüfling hat eine betriebliche Projektarbeit durchzuführen und mit praxisbezogenen Unterlagen zu dokumentieren. Vor der Durchführung der Projektarbeit hat er dem Prüfungsausschuss eine Projektbeschreibung zur Genehmigung vorzulegen. In der Projektbeschreibung hat er die Ausgangssituation und das Projektziel zu beschreiben und eine Zeitplanung aufzustellen. Die Prüfungszeit beträgt für die betriebliche Projektarbeit und für die Dokumentation mit praxisbezogenen Unterlagen höchstens 40 Stunden.
Im zweiten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
- 1.
-
die Arbeitsergebnisse adressatengerecht zu präsentieren und
- 2.
-
seine Vorgehensweisen bei der Durchführung der betrieblichen Projektarbeit zu begründen.
Der Prüfling hat die betriebliche Projektarbeit zu präsentieren. Nach der Präsentation wird mit ihm ein Fachgespräch über die betriebliche Projektarbeit und die präsentierten Arbeitsergebnisse geführt. Die Prüfungszeit beträgt insgesamt höchstens 30 Minuten. Die Präsentation soll höchstens 15 Minuten dauern.
Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind die Bewertungen wie folgt zu gewichten:
- 1.
-
die Bewertung für den ersten Teil mit 50 Prozent und
- 2.
-
die Bewertung für den zweiten Teil mit 50 Prozent.
Prüfungsbereich
Durchführen einer Prozessanalyse
Im Prüfungsbereich Durchführen einer Prozessanalyse hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
- 1.
-
einen Prozess darzustellen und Anforderungen im Prozess abzubilden,
- 2.
-
Analysewerkzeuge auszuwählen und anzuwenden,
- 3.
-
Maßnahmen zur Prozessoptimierung vorzuschlagen und deren rechtliche Auswirkungen, insbesondere auf die betrieblichen Abläufe, einzuschätzen und
- 4.
-
Maßnahmen zur Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitskontrolle zu planen und durchzuführen.
Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.
Prüfungsbereich
Sicherstellen der Datenqualität
Im Prüfungsbereich Sicherstellen der Datenqualität hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
- 1.
-
Daten zu identifizieren, zu klassifizieren und bereitzustellen,
- 2.
-
die Datenqualität zu prüfen und sicherzustellen,
- 3.
-
den Zugriff auf Daten und deren Verfügbarkeit zu gewährleisten sowie
- 4.
-
anwendungsbezogen sicherzustellen, dass die Bestimmungen des Datenschutzes und zur Datensicherheit eingehalten werden.
Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.
Prüfungsbereich
Wirtschafts- und Sozialkunde
Im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist, allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu beurteilen.
Die Prüfungsaufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.
Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprüfung
Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche sind in der Fachrichtung Daten- und Prozessanalyse wie folgt zu gewichten:
- 1.
-
Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes mit20 Prozent,
- 2.
-
Planen und Durchführen eines Projektes der Datenanalyse mit50 Prozent,
- 3.
-
Durchführen einer Prozessanalyse mit10 Prozent,
- 4.
-
Sicherstellen der Datenqualität mit10 Prozent sowie
- 5.
-
Wirtschafts- und Sozialkunde mit10 Prozent.
Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen – auch unter Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 33 – wie folgt bewertet worden sind:
- 1.
-
im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
- 2.
-
im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
- 3.
-
in mindestens drei Prüfungsbereichen von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“ und
- 4.
-
in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenügend“.
Mündliche Ergänzungsprüfung
Der Prüfling kann in einem Prüfungsbereich eine mündliche Ergänzungsprüfung beantragen.
Dem Antrag ist stattzugeben,
- 1.
-
wenn er für einen der folgenden Prüfungsbereiche gestellt worden ist:
- a)
-
Durchführen einer Prozessanalyse,
- b)
-
Sicherstellen der Datenqualität oder
- c)
-
Wirtschafts- und Sozialkunde,
- 2.
-
wenn der benannte Prüfungsbereich schlechter als mit „ausreichend“ bewertet worden ist und
- 3.
-
wenn die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen der Abschlussprüfung den Ausschlag geben kann.
Die mündliche Ergänzungsprüfung darf nur in einem einzigen Prüfungsbereich durchgeführt werden.
Die mündliche Ergänzungsprüfung soll 15 Minuten dauern.
Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2:1 zu gewichten.
Teil 2
der Abschlussprüfung in der Fachrichtung Digitale Vernetzung
Inhalt von Teil 2
Teil 2 der Abschlussprüfung erstreckt sich in der Fachrichtung Digitale Vernetzung auf
- 1.
-
die im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie
- 2.
-
den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.
In Teil 2 der Abschlussprüfung sollen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die bereits Gegenstand von Teil 1 der Abschlussprüfung waren, nur insoweit einbezogen werden, als es für die Feststellung der beruflichen Handlungsfähigkeit erforderlich ist.
Prüfungsbereiche von Teil 2
Teil 2 der Abschlussprüfung findet in der Fachrichtung Digitale Vernetzung in den folgenden Prüfungsbereichen statt:
- 1.
-
Planen und Umsetzen eines Projektes der digitalen Vernetzung,
- 2.
-
Diagnose und Störungsbeseitigung in vernetzten Systemen,
- 3.
-
Betrieb und Erweiterung von vernetzten Systemen sowie
- 4.
-
Wirtschafts- und Sozialkunde.
Prüfungsbereich
Planen und Umsetzen eines Projektes der digitalen Vernetzung
Im Prüfungsbereich Planen und Umsetzen eines Projektes der digitalen Vernetzung besteht die Prüfung aus zwei Teilen.
Im ersten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
- 1.
-
hardware- und softwarebasierte Schnittstellen und Komponenten in bestehende Infrastrukturen einzubinden und dabei die Anforderungen an die Informationssicherheit zu erfüllen,
- 2.
-
eine vorhandene Systemarchitektur über mehrere Prozessebenen und über deren Prozessabläufe zu bewerten, zu dokumentieren und zu visualisieren,
- 3.
-
Schnittstellen unterschiedlicher Prozesse und Systeme zu implementieren, zu konfigurieren und in Betrieb zu nehmen,
- 4.
-
Gesamtzusammenhänge in heterogenen IT-Landschaften zu bewerten und zu beschreiben sowie
- 5.
-
Übertragungssysteme anforderungsgerecht auszuwählen, zu konfigurieren und in die Gesamtinfrastruktur zu integrieren.
Der Prüfling hat eine betriebliche Projektarbeit durchzuführen und mit praxisbezogenen Unterlagen zu dokumentieren. Vor der Durchführung der Projektarbeit hat er dem Prüfungsausschuss eine Projektbeschreibung zur Genehmigung vorzulegen. In der Projektbeschreibung hat er die Ausgangssituation und das Projektziel zu beschreiben und eine Zeitplanung aufzustellen. Die Prüfungszeit beträgt für die betriebliche Projektarbeit und für die Dokumentation mit praxisbezogenen Unterlagen höchstens 40 Stunden.
Im zweiten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
- 1.
-
die Arbeitsergebnisse adressatengerecht zu präsentieren und
- 2.
-
seine Vorgehensweisen bei der Durchführung der betrieblichen Projektarbeit zu begründen.
Der Prüfling hat die betriebliche Projektarbeit zu präsentieren. Nach der Präsentation wird mit ihm über die betriebliche Projektarbeit und die präsentierten Arbeitsergebnisse ein Fachgespräch geführt. Die Prüfungszeit beträgt insgesamt höchstens 30 Minuten. Die Präsentation soll höchstens 15 Minuten dauern.
Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind die Bewertungen wie folgt zu gewichten:
- 1.
-
die Bewertung für den ersten Teil mit 50 Prozent und
- 2.
-
die Bewertung für den zweiten Teil mit 50 Prozent.
Prüfungsbereich
Diagnose und Störungsbeseitigung in vernetzten Systemen
Im Prüfungsbereich Diagnose und Störungsbeseitigung in vernetzten Systemen hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
- 1.
-
Soft- und Hardware zur Sicherstellung des Betriebes der Gesamtinfrastruktur und zur Störungsbeseitigung einzusetzen und Testergebnisse auszuwerten,
- 2.
-
Störungen in der Gesamtinfrastruktur zu lokalisieren und einzugrenzen sowie Lösungsmaßnahmen einzuleiten und umzusetzen,
- 3.
-
Diagnose- und Prozessdaten auszuwerten, zu analysieren und Maßnahmen abzuleiten und
- 4.
-
kunden- und anwendungsspezifische IT-Sicherheitsmaßnahmen im Gesamtsystem zu konfigurieren und zu implementieren, Schwachstellen zu bewerten und Maßnahmen einzuleiten.
Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.
Prüfungsbereich
Betrieb und Erweiterung von vernetzten Systemen
Im Prüfungsbereich Betrieb und Erweiterung von vernetzten Systemen hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
- 1.
-
technische Lösungskonzepte zur Einbindung von heterogenen Systemen sowie Protokollen in das Gesamtsystem zu bewerten und umzusetzen,
- 2.
-
die Kommunikation der unterschiedlichen Prozesse und Ebenen der Informationsverarbeitung zu prüfen und zu dokumentieren sowie deren Betrieb sicherzustellen,
- 3.
-
Systemressourcen zu überwachen, deren Kennzahlen zu bewerten und Maßnahmen zur Sicherstellung des Betriebes der vernetzten Systeme zu ergreifen und
- 4.
-
anwendungsspezifische Netzwerkinfrastrukturen und Protokolle zu beurteilen, anzupassen sowie zu erweitern.
Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.
Prüfungsbereich
Wirtschafts- und Sozialkunde
Im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist, allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu beurteilen.
Die Prüfungsaufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.
Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprüfung
Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche sind in der Fachrichtung Digitale Vernetzung wie folgt zu gewichten:
- 1.
-
Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes mit20 Prozent,
- 2.
-
Planen und Umsetzen eines Projektes der digitalen Vernetzung mit50 Prozent,
- 3.
-
Diagnose und Störungsbeseitigung in vernetzten Systemen mit10 Prozent,
- 4.
-
Betrieb und Erweiterung von vernetzten Systemen mit10 Prozent sowie
- 5.
-
Wirtschafts- und Sozialkunde mit10 Prozent.
Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen – auch unter Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 41 – wie folgt bewertet worden sind:
- 1.
-
im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
- 2.
-
im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
- 3.
-
in mindestens drei Prüfungsbereichen von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“ und
- 4.
-
in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenügend“.
Mündliche Ergänzungsprüfung
Der Prüfling kann in einem Prüfungsbereich eine mündliche Ergänzungsprüfung beantragen.
Dem Antrag ist stattzugeben,
- 1.
-
wenn er für einen der folgenden Prüfungsbereiche gestellt worden ist:
- a)
-
Diagnose und Störungsbeseitigung in vernetzten Systemen,
- b)
-
Betrieb und Erweiterung von vernetzten Systemen oder
- c)
-
Wirtschafts- und Sozialkunde,
- 2.
-
wenn der benannte Prüfungsbereich schlechter als mit „ausreichend“ bewertet worden ist und
- 3.
-
wenn die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen der Abschlussprüfung den Ausschlag geben kann.
Die mündliche Ergänzungsprüfung darf nur in einem einzigen Prüfungsbereich durchgeführt werden.
Die mündliche Ergänzungsprüfung soll 15 Minuten dauern.
Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2:1 zu gewichten.
Schlussvorschriften
Bestehende Berufsausbildungsverhältnisse
Berufsausbildungsverhältnisse zum Fachinformatiker/zur Fachinformatikerin, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung bereits bestehen, können nach den Vorschriften dieser Verordnung unter Anrechnung der bisher absolvierten Ausbildungszeit fortgesetzt werden, wenn die Vertragsparteien dies vereinbaren und der oder die Auszubildende noch nicht die Zwischenprüfung absolviert hat.
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. August 2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Berufsausbildung im Bereich der Informations- und Telekommunikationstechnik vom 10. Juli 1997 (BGBl. I S. 1741), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 28. Mai 2018 (BGBl. I S. 654) geändert worden ist, außer Kraft.
Der Bundesminister
für Wirtschaft und Energie
Nussbaum
(zu § 3 Absatz 1)
Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung zum Fachinformatiker und zur Fachinformatikerin
Abschnitt A: fachrichtungsübergreifende berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
| Lfd. Nr. |
Teil des Ausbildungsberufsbildes |
Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten |
Zeitliche Richtwerte in Wochen im |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. bis 18. Monat |
19. bis 36. Monat |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Planen, Vorbereiten und Durchführen von Arbeitsaufgaben in Abstimmung mit den kundenspezifischen Geschäfts- und Leistungsprozessen (§ 4 Absatz 2 Nummer 1) |
|
12 | |
| 2 | Informieren und Beraten von Kunden und Kundinnen (§ 4 Absatz 2 Nummer 2) |
|
3 | |
|
2 | |||
| 3 | Beurteilen marktgängiger IT-Systeme und kundenspezifischer Lösungen (§ 4 Absatz 2 Nummer 3) |
|
10 | |
|
5 | |||
| 4 | Entwickeln, Erstellen und Betreuen von IT-Lösungen (§ 4 Absatz 2 Nummer 4) |
|
5 | |
|
7 | |||
| 5 | Durchführen und Dokumentieren von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 2 Nummer 5) |
|
4 | |
|
8 | |||
| 6 | Umsetzen, Integrieren und Prüfen von Maßnahmen zur IT-Sicherheit und zum Datenschutz (§ 4 Absatz 2 Nummer 6) |
|
6 | |
|
6 | |||
| 7 | Erbringen der Leistungen und Auftragsabschluss (§ 4 Absatz 2 Nummer 7) |
|
7 | |
| 8 | Betreiben von IT-Systemen (§ 4 Absatz 2 Nummer 8) |
|
3 | |
|
3 | |||
| 9 | Inbetriebnehmen von Speicherlösungen (§ 4 Absatz 2 Nummer 9) |
|
5 | |
| 10 | Programmieren von Softwarelösungen (§ 4 Absatz 2 Nummer 10) |
|
5 | |
|
10 | |||
Abschnitt B: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung
| Lfd. Nr. |
Teil des Ausbildungsberufsbildes |
Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten |
Zeitliche Richtwerte in Wochen im |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. bis 18. Monat |
19. bis 36. Monat |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Konzipieren und Umsetzen von kundenspezifischen Softwareanwendungen (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
|
15 | |
|
25 | |||
| 2 | Sicherstellen der Qualität von Softwareanwendungen (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
|
5 | |
|
7 | |||
Abschnitt C: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung Systemintegration
| Lfd. Nr. |
Teil des Ausbildungsberufsbildes |
Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten |
Zeitliche Richtwerte in Wochen im |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. bis 18. Monat |
19. bis 36. Monat |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Konzipieren und Realisieren von IT-Systemen (§ 4 Absatz 4 Nummer 1) |
|
8 | |
|
12 | |||
| 2 | Installieren und Konfigurieren von Netzwerken (§ 4 Absatz 4 Nummer 2) |
|
5 | |
|
6 | |||
| 3 | Administrieren von IT-Systemen (§ 4 Absatz 4 Nummer 3) |
|
7 | |
|
14 | |||
Abschnitt D: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung Daten- und Prozessanalyse
| Lfd. Nr. |
Teil des Ausbildungsberufsbildes |
Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten |
Zeitliche Richtwerte in Wochen im |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. bis 18. Monat |
19. bis 36. Monat |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Analysieren von Arbeits- und Geschäftsprozessen (§ 4 Absatz 5 Nummer 1) |
|
8 | |
| 2 | Analysieren von Datenquellen und Bereitstellen von Daten (§ 4 Absatz 5 Nummer 2) |
|
5 | |
|
5 | |||
| 3 | Nutzen der Daten zur Optimierung von Arbeits- und Geschäftsprozessen sowie zur Optimierung digitaler Geschäftsmodelle (§ 4 Absatz 5 Nummer 3) |
|
6 | |
|
21 | |||
| 4 | Umsetzen des Datenschutzes und der Schutzziele der Datensicherheit (§ 4 Absatz 5 Nummer 4) |
|
1 | |
|
6 | |||
Abschnitt E: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung Digitale Vernetzung
| Lfd. Nr. |
Teil des Ausbildungsberufsbildes |
Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten |
Zeitliche Richtwerte in Wochen im |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. bis 18. Monat |
19. bis 36. Monat |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Analysieren und Planen von Systemen zur Vernetzung von Prozessen und Produkten (§ 4 Absatz 6 Nummer 1) |
|
12 | |
|
4 | |||
| 2 | Errichten, Ändern und Prüfen von vernetzten Systemen (§ 4 Absatz 6 Nummer 2) |
|
4 | |
|
13 | |||
| 3 | Betreiben von vernetzten Systemen und Sicherstellung der Systemverfügbarkeit (§ 4 Absatz 6 Nummer 3) |
|
4 | |
|
15 | |||
Abschnitt F: fachrichtungsübergreifende, integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
| Lfd. Nr. |
Teil des Ausbildungsberufsbildes |
Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten |
Zeitliche Richtwerte in Wochen im |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. bis 18. Monat |
19. bis 36. Monat |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht (§ 4 Absatz 7 Nummer 1) |
|
||
|
||||
| 2 | Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes (§ 4 Absatz 7 Nummer 2) |
|
während der gesamten Ausbildung |
|
| 3 | Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (§ 4 Absatz 7 Nummer 3) |
|
||
| 4 | Umweltschutz (§ 4 Absatz 7 Nummer 4) |
Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Einwirkungsbereich
beitragen, insbesondere
|
||
| 5 | Vernetztes Zusammenarbeiten unter Nutzung digitaler Medien (§ 4 Absatz 7 Nummer 5) |
|
3 | |
Verordnung
über die Berufsausbildung zum IT-System-Elektroniker und zur IT-System-Elektronikerin
(IT-System-Elektroniker-Ausbildungsverordnung – ITSEAusbV)
*
Auf Grund des § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes, der zuletzt durch Artikel 436 Nummer 1 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung:
Inhaltsübersicht
Gegenstand, Dauer und Gliederung der Berufsausbildung
| § 1 | Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes |
| § 2 | Dauer der Berufsausbildung |
| § 3 | Gegenstand der Berufsausbildung und Ausbildungsrahmenplan |
| § 4 | Struktur der Berufsausbildung, Ausbildungsberufsbild |
| § 5 | Ausbildungsplan |
Abschlussprüfung
| § 6 | Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt |
| § 7 | Inhalt von Teil 1 |
| § 8 | Prüfungsbereich von Teil 1 |
| § 9 | Inhalt von Teil 2 |
| § 10 | Prüfungsbereiche von Teil 2 |
| § 11 | Prüfungsbereich Erstellen, Ändern oder Erweitern von IT-Systemen und von deren Infrastruktur |
| § 12 | Prüfungsbereich Installation von und Service an IT-Geräten, IT-Systemen und IT-Infrastrukturen |
| § 13 | Prüfungsbereich Anbindung von Geräten, Systemen und Betriebsmitteln an die Stromversorgung |
| § 14 | Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde |
| § 15 | Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprüfung |
| § 16 | Mündliche Ergänzungsprüfung |
Schlussvorschriften
| § 17 | Bestehende Berufsausbildungsverhältnisse |
| § 18 | Inkrafttreten |
| Anlage: | Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum IT-System-Elektroniker und zur IT-System-Elektronikerin |
Gegenstand, Dauer und Gliederung der Berufsausbildung
Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes
Der Ausbildungsberuf des IT-System-Elektronikers und der IT-System-Elektronikerin wird nach § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes staatlich anerkannt.
Dauer der Berufsausbildung
Die Berufsausbildung dauert drei Jahre.
Gegenstand der Berufsausbildung und Ausbildungsrahmenplan
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die im Ausbildungsrahmenplan (Anlage) genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten. Von der Organisation der Berufsausbildung, wie sie im Ausbildungsrahmenplan vorgegeben ist, darf abgewichen werden, wenn und soweit betriebspraktische Besonderheiten oder Gründe, die in der Person des oder der Auszubildenden liegen, die Abweichung erfordern.
Die im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sollen so vermittelt werden, dass die Auszubildenden die berufliche Handlungsfähigkeit nach § 1 Absatz 3 des Berufsbildungsgesetzes erlangen. Die berufliche Handlungsfähigkeit schließt insbesondere selbständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren ein.
Struktur der Berufsausbildung, Ausbildungsberufsbild
Die Berufsausbildung gliedert sich in:
- 1.
-
berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie
- 2.
-
integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.
Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind als Teil des Ausbildungsberufsbildes gebündelt.
Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
- 1.
-
Planen, Vorbereiten und Durchführen von Arbeitsaufgaben in Abstimmung mit den kundenspezifischen Geschäfts- und Leistungsprozessen,
- 2.
-
Informieren und Beraten von Kunden und Kundinnen,
- 3.
-
Beurteilen marktgängiger IT-Systeme und kundenspezifischer Lösungen,
- 4.
-
Entwickeln, Erstellen und Betreuen von IT-Lösungen,
- 5.
-
Durchführen und Dokumentieren von qualitätssichernden Maßnahmen,
- 6.
-
Umsetzen, Integrieren und Prüfen von Maßnahmen zur IT-Sicherheit und zum Datenschutz,
- 7.
-
Erbringen der Leistungen und Auftragsabschluss,
- 8.
-
Installieren und Konfigurieren von IT-Geräten und IT-Systemen,
- 9.
-
Installieren von Netzwerkinfrastrukturen und Übertragungssystemen,
- 10.
-
Planen und Vorbereiten von Service- und Instandsetzungsmaßnahmen an IT-Geräten und IT-Systemen und an deren Infrastruktur,
- 11.
-
Durchführen von Service- und Instandsetzungsarbeiten an IT-Geräten und IT-Systemen und an deren Infrastruktur,
- 12.
-
Auftragsabschluss und Unterstützung von Nutzern und Nutzerinnen im Umgang mit IT-Geräten und IT-Systemen und mit deren Infrastruktur,
- 13.
-
IT-Sicherheit und Datenschutz in IT-Systemen, Netzwerkinfrastrukturen und Übertragungssystemen,
- 14.
-
Installieren von IT-Systemen, Geräten und Betriebsmitteln sowie deren Anbindung an die Stromversorgung und
- 15.
-
Prüfen der elektrischen Sicherheit von Geräten und Betriebsmitteln.
Die Berufsbildpositionen der integrativ zu vermittelnden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
- 1.
-
Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht,
- 2.
-
Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes,
- 3.
-
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,
- 4.
-
Umweltschutz und
- 5.
-
vernetztes Zusammenarbeiten unter Nutzung digitaler Medien.
Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind in einem der folgenden Einsatzgebiete zu vermitteln:
- 1.
-
digitale Infrastruktur,
- 2.
-
leitungsgebundene Netze,
- 3.
-
Funknetze,
- 4.
-
virtuelle Netze,
- 5.
-
Computersysteme,
- 6.
-
Endgeräte und
- 7.
-
Sicherheitssysteme.
Der Ausbildungsbetrieb legt fest, in welchem Einsatzgebiet die Vermittlung erfolgt. Der Ausbildungsbetrieb darf mit Zustimmung der zuständigen Stelle jedoch auch ein anderes Einsatzgebiet festlegen, wenn in diesem Einsatzgebiet die gleichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt werden.
Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der in Absatz 2 Nummer 1 bis 7 genannten Berufsbildpositionen sind im Bereich der IT-Berufe berufsübergreifend und werden in gleicher Weise auch in den folgenden Berufsausbildungen vermittelt:
- 1.
-
in der Berufsausbildung zum Kaufmann für Digitalisierungsmanagement und zur Kauffrau für Digitalisierungsmanagement nach der Digitalisierungsmanagement-Kaufleute-Ausbildungsverordnung vom 28. Februar 2020 (BGBl. I S. 290),
- 2.
-
in der Berufsausbildung zum Fachinformatiker und zur Fachinformatikerin nach der Fachinformatikerausbildungsverordnung vom 28. Februar 2020 (BGBl. I S. 250) und
- 3.
-
in der Berufsausbildung zum Kaufmann für IT-System-Management und zur Kauffrau für IT-System-Management nach der IT-System-Management-Kaufleute-Ausbildungsverordnung vom 28. Februar 2020 (BGBl. I S. 280).
Ausbildungsplan
Die Ausbildenden haben spätestens zu Beginn der Ausbildung auf der Grundlage des Ausbildungsrahmenplans für jeden Auszubildenden und für jede Auszubildende einen Ausbildungsplan zu erstellen.
Abschlussprüfung
Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt
Die Abschlussprüfung besteht aus den Teilen 1 und 2.
Teil 1 findet im vierten Ausbildungshalbjahr statt, Teil 2 am Ende der Berufsausbildung. Den jeweiligen Zeitpunkt legt die zuständige Stelle fest.
Inhalt von Teil 1
Teil 1 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf
- 1.
-
die im Ausbildungsrahmenplan für die ersten 18 Monate genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der Berufsbildpositionen nach § 4 Absatz 2 Nummer 1 bis 7 sowie
- 2.
-
den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.
Prüfungsbereich von Teil 1
Teil 1 der Abschlussprüfung findet im Prüfungsbereich Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes statt.
Im Prüfungsbereich Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
- 1.
-
Kundenbedarfe zielgruppengerecht zu ermitteln,
- 2.
-
Hard- und Software auszuwählen und ihre Beschaffung einzuleiten,
- 3.
-
einen IT-Arbeitsplatz zu konfigurieren und zu testen und dabei die Bestimmungen und die betrieblichen Vorgaben zum Datenschutz, zur IT-Sicherheit und zur Qualitätssicherung einzuhalten,
- 4.
-
Kunden und Kundinnen in die Nutzung des Arbeitsplatzes einzuweisen und
- 5.
-
die Leistungserbringung zu kontrollieren und zu protokollieren.
Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.
Inhalt von Teil 2
Teil 2 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf
- 1.
-
die im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie
- 2.
-
den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.
In Teil 2 der Abschlussprüfung sollen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die bereits Gegenstand von Teil 1 der Abschlussprüfung waren, nur insoweit einbezogen werden, als es für die Feststellung der beruflichen Handlungsfähigkeit erforderlich ist.
Prüfungsbereiche von Teil 2
Teil 2 der Abschlussprüfung findet in den folgenden Prüfungsbereichen statt:
- 1.
-
Erstellen, Ändern oder Erweitern von IT-Systemen und von deren Infrastruktur,
- 2.
-
Installation von und Service an IT-Geräten, IT-Systemen und IT-Infrastrukturen,
- 3.
-
Anbindung von Geräten, Systemen und Betriebsmitteln an die Stromversorgung sowie
- 4.
-
Wirtschafts- und Sozialkunde.
Prüfungsbereich
Erstellen, Ändern oder Erweitern von IT-Systemen und von deren Infrastruktur
Im Prüfungsbereich Erstellen, Ändern oder Erweitern von IT-Systemen und von deren Infrastruktur besteht die Prüfung aus zwei Teilen.
Im ersten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
- 1.
-
kundenspezifische Anforderungen unter Beachtung fachlicher und wirtschaftlicher Hintergründe zu analysieren,
- 2.
-
Projektanforderungen zu definieren und eine Projektplanung durchzuführen,
- 3.
-
IT-Systeme und ihre Komponenten auszuwählen und nach den jeweils geltenden Vorschriften und Normen zu installieren und zu konfigurieren,
- 4.
-
Geräte und Betriebsmittel nach den jeweils geltenden Vorschriften und Normen an eine Stromversorgung anzubinden,
- 5.
-
Verbindungen und Übertragungs- sowie Leitungswege auszuwählen, herzustellen und darzustellen,
- 6.
-
projektbezogene Funktionstests durchzuführen und die Ergebnisse zu dokumentieren sowie
- 7.
-
Projektergebnisse kundengerecht darzustellen und einen Projektabschluss durchzuführen.
Der Prüfling hat eine betriebliche Projektarbeit durchzuführen und mit praxisbezogenen Unterlagen zu dokumentieren. Vor der Durchführung der betrieblichen Projektarbeit hat er dem Prüfungsausschuss eine Projektbeschreibung zur Genehmigung vorzulegen. In der Projektbeschreibung hat er die Ausgangssituation und das Projektziel zu beschreiben und eine Zeitplanung aufzustellen. Die Prüfungszeit beträgt für die betriebliche Projektarbeit und für die Dokumentation mit praxisbezogenen Unterlagen höchstens 40 Stunden.
Im zweiten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
- 1.
-
die Arbeitsergebnisse adressatengerecht zu präsentieren und
- 2.
-
seine Vorgehensweise bei der Durchführung der betrieblichen Projektarbeit zu begründen.
Der Prüfling hat die betriebliche Projektarbeit zu präsentieren. Nach der Präsentation wird mit ihm ein Fachgespräch über die betriebliche Projektarbeit und die präsentierten Arbeitsergebnisse geführt. Die Prüfungszeit beträgt insgesamt höchstens 30 Minuten. Die Präsentation soll höchstens 15 Minuten dauern.
Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind die Bewertungen wie folgt zu gewichten:
- 1.
-
die Bewertung für den ersten Teil mit 50 Prozent und
- 2.
-
die Bewertung für den zweiten Teil mit 50 Prozent.
Prüfungsbereich
Installation von und Service an IT-Geräten, IT-Systemen und IT-Infrastrukturen
Im Prüfungsbereich Installation von und Service an IT-Geräten, IT-Systemen und IT-Infrastrukturen hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
- 1.
-
IT-Geräte und IT-Systeme nach den geltenden Vorschriften und Normen auf der Grundlage von bereitgestellten Planungsunterlagen zu installieren,
- 2.
-
IT-Geräte und IT-Systeme zu konfigurieren und in Betrieb zu nehmen,
- 3.
-
Netzwerkinfrastrukturen und Übertragungssysteme in Betrieb zu nehmen und zu erweitern sowie
- 4.
-
die Funktionsfähigkeit von IT-Systemen und von deren Komponenten zu prüfen und Störungen zu beseitigen.
Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.
Prüfungsbereich
Anbindung von Geräten, Systemen und Betriebsmitteln an die Stromversorgung
Im Prüfungsbereich Anbindung von Geräten, Systemen und Betriebsmitteln an die Stromversorgung hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
- 1.
-
die Stromversorgung von Systemen, Geräten und Betriebsmitteln zu planen und dazu insbesondere den erforderlichen Energiebedarf für Systeme, Geräte und Betriebsmittel zu ermitteln,
- 2.
-
Unterlagen, insbesondere Installations- und Stromlaufpläne, auszuwerten und selbst zu erstellen,
- 3.
-
Geräte und Betriebsmittel unter Beachtung von Betriebs- und Umgebungsbedingungen auszuwählen und festzulegen,
- 4.
-
Maßnahmen zum Schutz gegen elektrische Gefährdungen festzulegen,
- 5.
-
Prüfungen bezüglich der elektrischen Sicherheit zu beschreiben und zu begründen, insbesondere geeignete Mess- und Prüfmittel auszuwählen und Ergebnisse auszuwerten,
- 6.
-
Maßnahmen zur Beseitigung von Mängeln in der elektrischen Sicherheit von Systemen, Geräten und Betriebsmitteln zu beschreiben sowie
- 7.
-
die geltenden Vorschriften, Normen und Regeln der Technik anzuwenden.
Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.
Prüfungsbereich
Wirtschafts- und Sozialkunde
Im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist, allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu beurteilen.
Die Prüfungsaufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.
Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprüfung
Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewichten:
- 1.
-
Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes mit20 Prozent,
- 2.
-
Erstellen, Ändern oder Erweitern von IT-Systemen und von derenInfrastruktur mit50 Prozent,
- 3.
-
Installation von und Service an IT-Geräten, IT-Systemen und IT-Infrastrukturen mit10 Prozent,
- 4.
-
Anbindung von Geräten, Systemen und Betriebsmitteln an die Stromversorgung mit10 Prozent sowie
- 5.
-
Wirtschafts- und Sozialkunde mit10 Prozent.
Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen – auch unter Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 16 – wie folgt bewertet worden sind:
- 1.
-
im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
- 2.
-
im Prüfungsbereich Anbindung von Geräten, Systemen und Betriebsmitteln an die Stromversorgung mit mindestens „ausreichend“,
- 3.
-
in mindestens zwei weiteren Prüfungsbereichen von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“ und
- 4.
-
in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenügend“.
Mündliche Ergänzungsprüfung
Der Prüfling kann in einem Prüfungsbereich eine mündliche Ergänzungsprüfung beantragen.
Dem Antrag ist stattzugeben,
- 1.
-
wenn er für einen der folgenden Prüfungsbereiche gestellt worden ist:
- a)
-
Installation von und Service an IT-Geräten, IT-Systemen und IT-Infrastrukturen,
- b)
-
Anbindung von Geräten, Systemen und Betriebsmitteln an die Stromversorgung oder
- c)
-
Wirtschafts- und Sozialkunde,
- 2.
-
wenn der benannte Prüfungsbereich schlechter als mit „ausreichend“ bewertet worden ist und
- 3.
-
wenn die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen der Abschlussprüfung den Ausschlag geben kann.
Die mündliche Ergänzungsprüfung darf nur in einem einzigen Prüfungsbereich durchgeführt werden.
Die mündliche Ergänzungsprüfung soll 15 Minuten dauern.
Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2:1 zu gewichten.
Schlussvorschriften
Bestehende Berufsausbildungsverhältnisse
Berufsausbildungsverhältnisse zum Informations- und Telekommunikationssystem-Elektroniker/zur Informations- und Telekommunikationssystem-Elektronikerin, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung bereits bestehen, können nach den Vorschriften dieser Verordnung unter Anrechnung der bisher absolvierten Ausbildungszeit fortgesetzt werden, wenn die Vertragsparteien dies vereinbaren und der oder die Auszubildende noch nicht die Zwischenprüfung absolviert hat.
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. August 2020 in Kraft.
Der Bundesminister
für Wirtschaft und Energie
Nussbaum
(zu § 3 Absatz 1)
Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung zum IT-System-Elektroniker und zur IT-System-Elektronikerin
Abschnitt A: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
| Lfd. Nr. |
Teil des Ausbildungsberufsbildes |
Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten |
Zeitliche Richtwerte in Wochen im |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. bis 18. Monat |
19. bis 36. Monat |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Planen, Vorbereiten und Durchführen von Arbeitsaufgaben in Abstimmung mit den kundenspezifischen Geschäfts- und Leistungsprozessen (§ 4 Absatz 2 Nummer 1) |
|
12 | |
| 2 | Informieren und Beraten von Kunden und Kundinnen (§ 4 Absatz 2 Nummer 2) |
|
3 | |
|
2 | |||
| 3 | Beurteilen marktgängiger IT-Systeme und kundenspezifischer Lösungen (§ 4 Absatz 2 Nummer 3) |
|
10 | |
|
5 | |||
| 4 | Entwickeln, Erstellen und Betreuen von IT-Lösungen (§ 4 Absatz 2 Nummer 4) |
|
5 | |
|
7 | |||
| 5 | Durchführen und Dokumentieren von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 2 Nummer 5) |
|
4 | |
|
8 | |||
| 6 | Umsetzen, Integrieren und Prüfen von Maßnahmen zur IT-Sicherheit und zum Datenschutz (§ 4 Absatz 2 Nummer 6) |
|
6 | |
|
6 | |||
| 7 | Erbringen der Leistungen und Auftragsabschluss (§ 4 Absatz 2 Nummer 7) |
|
7 | |
| 8 | Installieren und Konfigurieren von IT-Geräten und IT-Systemen (§ 4 Absatz 2 Nummer 8) |
|
8 | |
|
8 | |||
| 9 | Installieren von Netzwerkinfrastrukturen und Übertragungssystemen (§ 4 Absatz 2 Nummer 9) |
|
2 | |
|
14 | |||
| 10 | Planen und Vorbereiten von Service- und Instandsetzungsmaßnahmen an IT-Geräten und IT-Systemen und an deren Infrastruktur (§ 4 Absatz 2 Nummer 10) |
|
5 | |
| 11 | Durchführen von Service- und Instandsetzungsarbeiten an IT-Geräten und IT-Systemen
und an deren Infrastruktur (§ 4 Absatz 2 Nummer 11) |
|
3 | |
|
8 | |||
| 12 | Auftragsabschluss und Unterstützung von Nutzern und Nutzerinnen im Umgang mit IT-Geräten und IT-Systemen und mit deren Infrastruktur (§ 4 Absatz 2 Nummer 12) |
|
2 | |
|
3 | |||
| 13 | IT-Sicherheit und Datenschutz in IT-Systemen, Netzwerkinfrastrukturen und Übertragungssystemen (§ 4 Absatz 2 Nummer 13) |
|
5 | |
| 14 | Installieren von IT-Systemen, Geräten und Betriebsmitteln sowie deren Anbindung an
die Stromversorgung (§ 4 Absatz 2 Nummer 14) |
|
13 | |
|
1 | |||
| 15 | Prüfen der elektrischen Sicherheit von Geräten und Betriebsmitteln (§ 4 Absatz 2 Nummer 15) |
|
6 | |
Abschnitt B: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
| Lfd. Nr. |
Teil des Ausbildungsberufsbildes |
Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten |
Zeitliche Richtwerte in Wochen im |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. bis 18. Monat |
19. bis 36. Monat |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
|
||
|
||||
| 2 | Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
|
während der gesamten Ausbildung |
|
| 3 | Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (§ 4 Absatz 3 Nummer 3) |
|
||
| 4 | Umweltschutz (§ 4 Absatz 3 Nummer 4) |
Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Einwirkungsbereich
beitragen, insbesondere
|
||
| 5 | Vernetztes Zusammenarbeiten unter Nutzung digitaler Medien (§ 4 Absatz 3 Nummer 5) |
|
3 | |
Verordnung
über die Berufsausbildung
zum Kaufmann für IT-System-Management und zur Kauffrau für IT-System-Management
(IT-System-Management-Kaufleute-Ausbildungsverordnung – ITSManKflAusbV)*
Auf Grund des § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes, der zuletzt durch Artikel 436 Nummer 1 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung:
Inhaltsübersicht
Gegenstand, Dauer und Gliederung der Berufsausbildung
| § 1 | Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes |
| § 2 | Dauer der Berufsausbildung |
| § 3 | Gegenstand der Berufsausbildung und Ausbildungsrahmenplan |
| § 4 | Struktur der Berufsausbildung, Ausbildungsberufsbild |
| § 5 | Ausbildungsplan |
Abschlussprüfung
| § 6 | Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt |
| § 7 | Inhalt von Teil 1 |
| § 8 | Prüfungsbereich von Teil 1 |
| § 9 | Inhalt von Teil 2 |
| § 10 | Prüfungsbereiche von Teil 2 |
| § 11 | Prüfungsbereich Abwicklung eines Kundenauftrages |
| § 12 | Prüfungsbereich Einführen einer IT-Systemlösung |
| § 13 | Prüfungsbereich Kaufmännische Unterstützungsprozesse |
| § 14 | Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde |
| § 15 | Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprüfung |
| § 16 | Mündliche Ergänzungsprüfung |
Schlussvorschriften
| § 17 | Bestehende Berufsausbildungsverhältnisse |
| § 18 | Inkrafttreten |
| Anlage: | Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Kaufmann für IT-System-Management und zur Kauffrau für IT-System-Management |
Gegenstand, Dauer und Gliederung der Berufsausbildung
Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes
Der Ausbildungsberuf des Kaufmanns für IT-System-Management und der Kauffrau für IT-System-Management wird nach § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes staatlich anerkannt.
Dauer der Berufsausbildung
Die Berufsausbildung dauert drei Jahre.
Gegenstand der Berufsausbildung und Ausbildungsrahmenplan
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die im Ausbildungsrahmenplan (Anlage) genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten. Von der Organisation der Berufsausbildung, wie sie im Ausbildungsrahmenplan vorgegeben ist, darf abgewichen werden, wenn und soweit betriebspraktische Besonderheiten oder Gründe, die in der Person des oder der Auszubildenden liegen, die Abweichung erfordern.
Die im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sollen so vermittelt werden, dass die Auszubildenden die berufliche Handlungsfähigkeit nach § 1 Absatz 3 des Berufsbildungsgesetzes erlangen. Die berufliche Handlungsfähigkeit schließt insbesondere selbständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren ein.
Struktur der Berufsausbildung, Ausbildungsberufsbild
Die Berufsausbildung gliedert sich in:
- 1.
-
berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie
- 2.
-
integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.
Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind als Teil des Ausbildungsberufsbildes gebündelt.
Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
- 1.
-
Planen, Vorbereiten und Durchführen von Arbeitsaufgaben in Abstimmung mit den kundenspezifischen Geschäfts- und Leistungsprozessen,
- 2.
-
Informieren und Beraten von Kunden und Kundinnen,
- 3.
-
Beurteilen marktgängiger IT-Systeme und kundenspezifischer Lösungen,
- 4.
-
Entwickeln, Erstellen und Betreuen von IT-Lösungen,
- 5.
-
Durchführen und Dokumentieren von qualitätssichernden Maßnahmen,
- 6.
-
Umsetzen, Integrieren und Prüfen von Maßnahmen zur IT-Sicherheit und zum Datenschutz,
- 7.
-
Erbringen der Leistungen und Auftragsabschluss,
- 8.
-
Analysieren von Anforderungen an IT-Systeme,
- 9.
-
Entwickeln und Umsetzen von Beratungsstrategien,
- 10.
-
Entwickeln von Konzepten für IT-Lösungen und Koordinieren von deren Umsetzung,
- 11.
-
Erstellen von Angeboten und Abschließen von Verträgen,
- 12.
-
Anwenden von Instrumenten aus dem Absatzmarketing und aus dem Vertrieb,
- 13.
-
Anwenden von Instrumenten der kaufmännischen Steuerung und Kontrolle sowie
- 14.
-
Beschaffen von Hard- und Software sowie von Dienstleistungen.
Die Berufsbildpositionen der integrativ zu vermittelnden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
- 1.
-
Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht,
- 2.
-
Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes,
- 3.
-
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,
- 4.
-
Umweltschutz und
- 5.
-
vernetztes Zusammenarbeiten unter Nutzung digitaler Medien.
Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind in einem der folgenden Einsatzgebiete zu vermitteln:
- 1.
-
technischer IT-Service,
- 2.
-
IT-System-Betreuung,
- 3.
-
Vertrieb im Geschäftskunden- und im Privatkundenbereich,
- 4.
-
Marketing und
- 5.
-
Produkt- und Programmentwicklung.
Der Ausbildungsbetrieb legt fest, in welchem Einsatzgebiet die Vermittlung erfolgt. Der Ausbildungsbetrieb darf mit Zustimmung der zuständigen Stelle jedoch auch ein anderes Einsatzgebiet festlegen, wenn in diesem Einsatzgebiet die gleichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt werden.
Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der in Absatz 2 Nummer 1 bis 7 genannten Berufsbildpositionen sind im Bereich der IT-Berufe berufsübergreifend und werden in gleicher Weise auch in den folgenden Berufsausbildungen vermittelt:
- 1.
-
in der Berufsausbildung zum Fachinformatiker und zur Fachinformatikerin nach der Fachinformatikerausbildungsverordnung vom 28. Februar 2020 (BGBl. I S. 250),
- 2.
-
in der Berufsausbildung zum IT-System-Elektroniker und zur IT-System-Elektronikerin nach der IT-System-Elektroniker-Ausbildungsverordnung vom 28. Februar 2020 (BGBl. I S. 268) und
- 3.
-
in der Berufsausbildung zum Kaufmann für Digitalisierungsmanagement und zur Kauffrau für Digitalisierungsmanagement nach der Digitalisierungsmanagement-Kaufleute-Ausbildungsverordnung vom 28. Februar 2020 (BGBl. I S. 290).
Ausbildungsplan
Die Ausbildenden haben spätestens zu Beginn der Ausbildung auf der Grundlage des Ausbildungsrahmenplans für jeden Auszubildenden und für jede Auszubildende einen Ausbildungsplan zu erstellen.
Abschlussprüfung
Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt
Die Abschlussprüfung besteht aus den Teilen 1 und 2.
Teil 1 findet im vierten Ausbildungshalbjahr statt, Teil 2 am Ende der Berufsausbildung. Den jeweiligen Zeitpunkt legt die zuständige Stelle fest.
Inhalt von Teil 1
Teil 1 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf
- 1.
-
die im Ausbildungsrahmenplan für die ersten 18 Monate genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der Berufsbildpositionen nach § 4 Absatz 2 Nummer 1 bis 7 sowie
- 2.
-
den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.
Prüfungsbereich von Teil 1
Teil 1 der Abschlussprüfung findet im Prüfungsbereich Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes statt.
Im Prüfungsbereich Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
- 1.
-
Kundenbedarfe zielgruppengerecht zu ermitteln,
- 2.
-
Hard- und Software auszuwählen und ihre Beschaffung einzuleiten,
- 3.
-
einen IT-Arbeitsplatz zu konfigurieren und zu testen und dabei die Bestimmungen und die betrieblichen Vorgaben zum Datenschutz, zur IT-Sicherheit und zur Qualitätssicherung einzuhalten,
- 4.
-
Kunden und Kundinnen in die Nutzung des Arbeitsplatzes einzuweisen und
- 5.
-
die Leistungserbringung zu kontrollieren und zu protokollieren.
Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.
Inhalt von Teil 2
Teil 2 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf
- 1.
-
die im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie
- 2.
-
den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.
In Teil 2 der Abschlussprüfung sollen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die bereits Gegenstand von Teil 1 der Abschlussprüfung waren, nur insoweit einbezogen werden, als es für die Feststellung der beruflichen Handlungsfähigkeit erforderlich ist.
Prüfungsbereiche von Teil 2
Teil 2 der Abschlussprüfung findet in den folgenden Prüfungsbereichen statt:
- 1.
-
Abwicklung eines Kundenauftrages,
- 2.
-
Einführen einer IT-Systemlösung,
- 3.
-
Kaufmännische Unterstützungsprozesse sowie
- 4.
-
Wirtschafts- und Sozialkunde.
Prüfungsbereich
Abwicklung eines Kundenauftrages
Im Prüfungsbereich Abwicklung eines Kundenauftrages besteht die Prüfung aus zwei Teilen.
Im ersten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
- 1.
-
Kunden und Kundinnen auftragsbezogen zu beraten und zu begleiten,
- 2.
-
kundenspezifische Anforderungen zu analysieren,
- 3.
-
eine Projektplanung durchzuführen,
- 4.
-
eine wirtschaftliche Betrachtung des Projektes vorzunehmen,
- 5.
-
IT-Systemlösungen auszuwählen, einzukaufen oder anzupassen,
- 6.
-
die Umsetzung der IT-Systemlösungen zu koordinieren und die Einführung zu begleiten und
- 7.
-
den Projektabschluss durchzuführen.
Der Prüfling hat eine betriebliche Projektarbeit durchzuführen und mit praxisbezogenen Unterlagen zu dokumentieren. Vor der Durchführung der betrieblichen Projektarbeit hat er dem Prüfungsausschuss eine Projektbeschreibung zur Genehmigung vorzulegen. In der Projektbeschreibung hat er die Ausgangssituation und das Projektziel zu beschreiben und eine Zeitplanung aufzustellen. Die Prüfungszeit beträgt für die betriebliche Projektarbeit und für die Dokumentation mit praxisbezogenen Unterlagen höchstens 40 Stunden.
Im zweiten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
- 1.
-
die Arbeitsergebnisse adressatengerecht zu präsentieren und
- 2.
-
seine Vorgehensweise bei der Durchführung der betrieblichen Projektarbeit zu begründen.
Der Prüfling hat die betriebliche Projektarbeit zu präsentieren. Nach der Präsentation wird mit ihm ein Fachgespräch über die betriebliche Projektarbeit und die präsentierten Arbeitsergebnisse geführt. Die Prüfungszeit beträgt insgesamt höchstens 30 Minuten. Die Präsentation soll höchstens 15 Minuten dauern.
Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind die Bewertungen wie folgt zu gewichten:
- 1.
-
die Bewertung für den ersten Teil mit 50 Prozent und
- 2.
-
die Bewertung für den zweiten Teil mit 50 Prozent.
Prüfungsbereich
Einführen einer IT-Systemlösung
Im Prüfungsbereich Einführen einer IT-Systemlösung hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
- 1.
-
Hard- und Software sowie Dienstleistungen zu beschaffen,
- 2.
-
Produktinformationen einzuholen und Angebotsvergleiche durchzuführen,
- 3.
-
Vertragsarten und Lizenzmodelle zu unterscheiden und bedarfsgerecht auszuwählen,
- 4.
-
Kundeninformationen aufzubereiten und für vertriebliche Zwecke zu nutzen,
- 5.
-
eine Kalkulation zu erstellen,
- 6.
-
die Bestimmungen zum Datenschutz anzuwenden und
- 7.
-
die Bestimmungen zur IT-Sicherheit anzuwenden.
Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.
Prüfungsbereich
Kaufmännische Unterstützungsprozesse
Im Prüfungsbereich Kaufmännische Unterstützungsprozesse hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
- 1.
-
Instrumente des Rechnungswesens für die kaufmännische Planung, Steuerung und Kontrolle zu nutzen und Handlungsvorschläge abzuleiten,
- 2.
-
Vertrags- und Finanzierungsarten zu unterscheiden, Kunden und Kundinnen zu beraten und Verträge vorzubereiten,
- 3.
-
Instrumente des Marketings und Vertriebs zielgruppengerecht anzuwenden sowie
- 4.
-
die Leistungserbringung zu kontrollieren und zu dokumentieren und bei Störung Maßnahmen zu deren Behebung abzuleiten.
Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.
Prüfungsbereich
Wirtschafts- und Sozialkunde
Im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist, allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu beurteilen.
Die Prüfungsaufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.
Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprüfung
Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewichten:
- 1.
-
Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes mit20 Prozent,
- 2.
-
Abwicklung eines Kundenauftrages mit50 Prozent,
- 3.
-
Einführen einer IT-Systemlösung mit10 Prozent,
- 4.
-
Kaufmännische Unterstützungsprozesse mit10 Prozent sowie
- 5.
-
Wirtschafts- und Sozialkunde mit10 Prozent.
Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen – auch unter Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 16 – wie folgt bewertet worden sind:
- 1.
-
im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
- 2.
-
im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
- 3.
-
in mindestens drei Prüfungsbereichen von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“ und
- 4.
-
in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenügend“.
Mündliche Ergänzungsprüfung
Der Prüfling kann in einem Prüfungsbereich eine mündliche Ergänzungsprüfung beantragen.
Dem Antrag ist stattzugeben,
- 1.
-
wenn er für einen der folgenden Prüfungsbereiche gestellt worden ist:
- a)
-
Einführen einer IT-Systemlösung,
- b)
-
Kaufmännische Unterstützungsprozesse oder
- c)
-
Wirtschafts- und Sozialkunde,
- 2.
-
wenn der benannte Prüfungsbereich schlechter als mit „ausreichend“ bewertet worden ist und
- 3.
-
wenn die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen der Abschlussprüfung den Ausschlag geben kann.
Die mündliche Ergänzungsprüfung darf nur in einem einzigen Prüfungsbereich durchgeführt werden.
Die mündliche Ergänzungsprüfung soll 15 Minuten dauern.
Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2:1 zu gewichten.
Schlussvorschriften
Bestehende Berufsausbildungsverhältnisse
Berufsausbildungsverhältnisse zum Informations- und Telekommunikationssystem-Kaufmann/zur Informations- und Telekommunikationssystem-Kauffrau, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung bereits bestehen, können nach den Vorschriften dieser Verordnung unter Anrechnung der bisher absolvierten Ausbildungszeit fortgesetzt werden, wenn die Vertragsparteien dies vereinbaren und der oder die Auszubildende noch nicht die Zwischenprüfung absolviert hat.
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. August 2020 in Kraft.
Der Bundesminister
für Wirtschaft und Energie
Nussbaum
(zu § 3 Absatz 1)
Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung
zum Kaufmann für IT-System-Management und zur Kauffrau für IT-System-Management
Abschnitt A: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
| Lfd. Nr. |
Teil des Ausbildungsberufsbildes |
Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten |
Zeitliche Richtwerte in Wochen im |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. bis 18. Monat |
19. bis 36. Monat |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Planen, Vorbereiten und Durchführen von Arbeitsaufgaben in Abstimmung mit den kundenspezifischen
Geschäfts- und Leistungsprozessen (§ 4 Absatz 2 Nummer 1) |
|
12 | |
| 2 | Informieren und Beraten von Kunden und Kundinnen (§ 4 Absatz 2 Nummer 2) |
|
3 | |
|
2 | |||
| 3 | Beurteilen marktgängiger IT-Systeme und kundenspezifischer Lösungen (§ 4 Absatz 2 Nummer 3) |
|
10 | |
|
5 | |||
| 4 | Entwickeln, Erstellen und Betreuen von IT-Lösungen (§ 4 Absatz 2 Nummer 4) |
|
5 | |
|
7 | |||
| 5 | Durchführen und Dokumentieren von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 2 Nummer 5) |
|
4 | |
|
8 | |||
| 6 | Umsetzen, Integrieren und Prüfen von Maßnahmen zur IT-Sicherheit und zum Datenschutz (§ 4 Absatz 2 Nummer 6) |
|
6 | |
|
6 | |||
| 7 | Erbringen der Leistungen und Auftragsabschluss (§ 4 Absatz 2 Nummer 7) |
|
7 | |
| 8 | Analysieren von Anforderungen an IT-Systeme (§ 4 Absatz 2 Nummer 8) |
|
6 | |
|
12 | |||
| 9 | Entwickeln und Umsetzen von Beratungsstrategien (§ 4 Absatz 2 Nummer 9) |
|
8 | |
|
10 | |||
| 10 | Entwickeln von Konzepten für IT-Lösungen und Koordinieren von deren Umsetzung (§ 4 Absatz 2 Nummer 10) |
|
4 | |
|
10 | |||
|
||||
| 11 | Erstellen von Angeboten und Abschließen von Verträgen (§ 4 Absatz 2 Nummer 11) |
|
2 | |
|
6 | |||
| 12 | Anwenden von Instrumenten aus dem Absatzmarketing und aus dem Vertrieb (§ 4 Absatz 2 Nummer 12) |
|
6 | |
| 13 | Anwenden von Instrumenten der kaufmännischen Steuerung und Kontrolle (§ 4 Absatz 2 Nummer 13) |
|
6 | |
| 14 | Beschaffen von Hard- und Software sowie von Dienstleistungen (§ 4 Absatz 2 Nummer 14) |
|
2 | |
|
6 | |||
Abschnitt B: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
| Lfd. Nr. |
Teil des Ausbildungsberufsbildes |
Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten |
Zeitliche Richtwerte in Wochen im |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. bis 15. Monat |
16. bis 36. Monat |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht, (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
|
||
| 2 | Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
|
während der gesamten Ausbildung |
|
| 3 | Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (§ 4 Absatz 3 Nummer 3) |
|
||
|
||||
| 4 | Umweltschutz (§ 4 Absatz 3 Nummer 4) |
Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Einwirkungsbereich
beitragen, insbesondere
|
||
| 5 | Vernetztes Zusammenarbeiten unter Nutzung digitaler Medien (§ 4 Absatz 3 Nummer 5) |
|
3 | |
Verordnung
über die Berufsausbildung zum Kaufmann für
Digitalisierungsmanagement und zur Kauffrau für Digitalisierungsmanagement
(Digitalisierungsmanagement-Kaufleute-Ausbildungsverordnung – DigiManKflAusbV)
*
Auf Grund des § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes, der zuletzt durch Artikel 436 Nummer 1 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung:
Inhaltsübersicht
Gegenstand, Dauer und Gliederung der Berufsausbildung
| § 1 | Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes |
| § 2 | Dauer der Berufsausbildung |
| § 3 | Gegenstand der Berufsausbildung und Ausbildungsrahmenplan |
| § 4 | Struktur der Berufsausbildung, Ausbildungsberufsbild |
| § 5 | Ausbildungsplan |
Abschlussprüfung
| § 6 | Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt |
| § 7 | Inhalt von Teil 1 |
| § 8 | Prüfungsbereich von Teil 1 |
| § 9 | Inhalt von Teil 2 |
| § 10 | Prüfungsbereiche von Teil 2 |
| § 11 | Prüfungsbereich Digitale Entwicklung von Prozessen |
| § 12 | Prüfungsbereich Entwicklung eines digitalen Geschäftsmodells |
| § 13 | Prüfungsbereich Kaufmännische Unterstützungsprozesse |
| § 14 | Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde |
| § 15 | Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprüfung |
| § 16 | Mündliche Ergänzungsprüfung |
Schlussvorschriften
| § 17 | Bestehende Berufsausbildungsverhältnisse |
| § 18 | Inkrafttreten |
| Anlage: | Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Kaufmann für Digitalisierungsmanagement und zur Kauffrau für Digitalisierungsmanagement |
Gegenstand, Dauer und Gliederung der Berufsausbildung
Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes
Der Ausbildungsberuf des Kaufmanns für Digitalisierungsmanagement und der Kauffrau für Digitalisierungsmanagement wird nach § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes staatlich anerkannt.
Dauer der Berufsausbildung
Die Berufsausbildung dauert drei Jahre.
Gegenstand der Berufsausbildung und Ausbildungsrahmenplan
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die im Ausbildungsrahmenplan (Anlage) genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten. Von der Organisation der Berufsausbildung, wie sie im Ausbildungsrahmenplan vorgegeben ist, darf abgewichen werden, wenn und soweit betriebspraktische Besonderheiten oder Gründe, die in der Person des oder der Auszubildenden liegen, die Abweichung erfordern.
Die im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sollen so vermittelt werden, dass die Auszubildenden die berufliche Handlungsfähigkeit nach § 1 Absatz 3 des Berufsbildungsgesetzes erlangen. Die berufliche Handlungsfähigkeit schließt insbesondere selbständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren ein.
Struktur der Berufsausbildung, Ausbildungsberufsbild
Die Berufsausbildung gliedert sich in:
- 1.
-
berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie
- 2.
-
integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.
Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind in Berufsbildpositionen als Teil des Ausbildungsberufsbildes gebündelt.
Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
- 1.
-
Planen, Vorbereiten und Durchführen von Arbeitsaufgaben in Abstimmung mit den kundenspezifischen Geschäfts- und Leistungsprozessen,
- 2.
-
Informieren und Beraten von Kunden und Kundinnen,
- 3.
-
Beurteilen marktgängiger IT-Systeme und kundenspezifischer Lösungen,
- 4.
-
Entwickeln, Erstellen und Betreuen von IT-Lösungen,
- 5.
-
Durchführen und Dokumentieren von qualitätssichernden Maßnahmen,
- 6.
-
Umsetzen, Integrieren und Prüfen von Maßnahmen zur IT-Sicherheit und zum Datenschutz,
- 7.
-
Erbringen der Leistungen und Auftragsabschluss,
- 8.
-
Analysieren von Arbeits-, Geschäfts- und Wertschöpfungsprozessen,
- 9.
-
Ermitteln des Bedarfs an Informationen und Bereitstellen von Daten,
- 10.
-
digitale Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen,
- 11.
-
Anbahnen und Gestalten von Verträgen,
- 12.
-
Planen und Durchführen von Beschaffungen,
- 13.
-
Anwenden von Instrumenten der kaufmännischen Steuerung und Kontrolle,
- 14.
-
Umsetzen der Schutzziele der Datensicherheit und
- 15.
-
Einhalten der Bestimmungen zum Datenschutz und zu weiteren Schutzrechten.
Die Berufsbildpositionen der integrativ zu vermittelnden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:
- 1.
-
Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht,
- 2.
-
Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes,
- 3.
-
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,
- 4.
-
Umweltschutz und
- 5.
-
vernetztes Zusammenarbeiten unter Nutzung digitaler Medien.
Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind in einem der folgenden Einsatzgebiete zu vermitteln:
- 1.
-
betriebliche Steuerung und Kontrolle,
- 2.
-
Organisations- und Prozessentwicklung,
- 3.
-
Produktentwicklung und Marketing sowie
- 4.
-
IT-Systemlösungen.
Der Ausbildungsbetrieb legt fest, in welchem Einsatzgebiet die Vermittlung erfolgt. Der Ausbildungsbetrieb darf mit Zustimmung der zuständigen Stelle jedoch auch ein anderes Einsatzgebiet festlegen, wenn in diesem Einsatzgebiet die gleichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt werden.
Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der in Absatz 2 Nummer 1 bis 7 genannten Berufsbildpositionen sind im Bereich der IT-Berufe berufsübergreifend und werden in gleicher Weise auch in den folgenden Berufsausbildungen vermittelt:
- 1.
-
in der Berufsausbildung zum Fachinformatiker und zur Fachinformatikerin nach der Fachinformatikerausbildungsverordnung vom 28. Februar 2020 (BGBl. I S. 250),
- 2.
-
in der Berufsausbildung zum IT-System-Elektroniker und zur IT-System-Elektronikerin nach der IT-System-Elektroniker-Ausbildungsverordnung vom 28. Februar 2020 (BGBl. I S. 268) und
- 3.
-
in der Berufsausbildung zum Kaufmann für IT-System-Management und zur Kauffrau für IT-System-Management nach der IT-System-Management-Kaufleute-Ausbildungsverordnung vom 28. Februar 2020 (BGBl. I S. 280).
Ausbildungsplan
Die Ausbildenden haben spätestens zu Beginn der Ausbildung auf der Grundlage des Ausbildungsrahmenplans für jeden Auszubildenden und für jede Auszubildende einen Ausbildungsplan zu erstellen.
Abschlussprüfung
Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt
Die Abschlussprüfung besteht aus den Teilen 1 und 2.
Teil 1 findet im vierten Ausbildungshalbjahr statt, Teil 2 am Ende der Berufsausbildung. Den jeweiligen Zeitpunkt legt die zuständige Stelle fest.
Inhalt von Teil 1
Teil 1 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf
- 1.
-
die im Ausbildungsrahmenplan für die ersten 18 Monate genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der Berufsbildpositionen nach § 4 Absatz 2 Nummer 1 bis 7 sowie
- 2.
-
den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.
Prüfungsbereich von Teil 1
Teil 1 der Abschlussprüfung findet im Prüfungsbereich Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes statt.
Im Prüfungsbereich Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
- 1.
-
Kundenbedarfe zielgruppengerecht zu ermitteln,
- 2.
-
Hard- und Software auszuwählen und ihre Beschaffung einzuleiten,
- 3.
-
einen IT-Arbeitsplatz zu konfigurieren und zu testen und dabei die Bestimmungen und die betrieblichen Vorgaben zum Datenschutz, zur IT-Sicherheit und zur Qualitätssicherung einzuhalten,
- 4.
-
Kunden und Kundinnen in die Nutzung des Arbeitsplatzes einzuweisen und
- 5.
-
die Leistungserbringung zu kontrollieren und zu protokollieren.
Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.
Inhalt von Teil 2
Teil 2 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf
- 1.
-
die im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie
- 2.
-
den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.
In Teil 2 der Abschlussprüfung sollen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die bereits Gegenstand von Teil 1 der Abschlussprüfung waren, nur insoweit einbezogen werden, als es für die Feststellung der beruflichen Handlungsfähigkeit erforderlich ist.
Prüfungsbereiche von Teil 2
Teil 2 der Abschlussprüfung findet in den folgenden Prüfungsbereichen statt:
- 1.
-
Digitale Entwicklung von Prozessen,
- 2.
-
Entwicklung eines digitalen Geschäftsmodells,
- 3.
-
Kaufmännische Unterstützungsprozesse sowie
- 4.
-
Wirtschafts- und Sozialkunde.
Prüfungsbereich
Digitale Entwicklung von Prozessen
Im Prüfungsbereich Digitale Entwicklung von Prozessen besteht die Prüfung aus zwei Teilen.
Im ersten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
- 1.
-
Arbeits-, Geschäfts- und Wertschöpfungsprozesse zu analysieren,
- 2.
-
Digitalisierungsvorhaben unter wirtschaftlicher Betrachtung zu planen,
- 3.
-
Daten zu erheben, zu kategorisieren und bereitzustellen,
- 4.
-
Prozessdaten auszuwählen und Entscheidungsoptionen abzuleiten,
- 5.
-
die Durchführung eines Kundenauftrags zu begleiten,
- 6.
-
Datenschutz und -sicherheit sicherzustellen und
- 7.
-
Projektergebnisse kundengerecht darzustellen.
Der Prüfling hat eine betriebliche Projektarbeit durchzuführen und mit praxisbezogenen Unterlagen zu dokumentieren. Vor der Durchführung der betrieblichen Projektarbeit hat er dem Prüfungsausschuss eine Projektbeschreibung zur Genehmigung vorzulegen. In der Projektbeschreibung hat er die Ausgangssituation und das Projektziel zu beschreiben und eine Zeitplanung aufzustellen. Die Prüfungszeit beträgt für die betriebliche Projektarbeit und für die Dokumentation mit praxisbezogenen Unterlagen höchstens 40 Stunden.
Im zweiten Teil hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
- 1.
-
die Arbeitsergebnisse adressatengerecht zu präsentieren und
- 2.
-
seine Vorgehensweisen bei der Durchführung der betrieblichen Projektarbeit zu begründen.
Der Prüfling hat die betriebliche Projektarbeit zu präsentieren. Nach der Präsentation wird mit ihm ein Fachgespräch über die betriebliche Projektarbeit und die präsentierten Arbeitsergebnisse geführt. Die Prüfungszeit beträgt insgesamt höchstens 30 Minuten. Die Präsentation soll höchstens 15 Minuten dauern.
Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind die Bewertungen wie folgt zu gewichten:
- 1.
-
die Bewertung für den ersten Teil mit 50 Prozent und
- 2.
-
die Bewertung für den zweiten Teil mit 50 Prozent.
Prüfungsbereich
Entwicklung eines digitalen Geschäftsmodells
Im Prüfungsbereich Entwicklung eines digitalen Geschäftsmodells hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
- 1.
-
Arbeits- und Geschäftsprozesse im Hinblick auf Digitalisierungsgrad, Optimierungsmöglichkeiten, Kosten und Wertschöpfung zu analysieren,
- 2.
-
den Kundennutzen zu kalkulieren,
- 3.
-
digitale Geschäftsmodelle zu unterscheiden,
- 4.
-
Vertragsarten und Lizenzmodelle zu unterscheiden und bedarfsgerecht auszuwählen,
- 5.
-
die Bestimmungen zum Datenschutz anzuwenden und
- 6.
-
die Bestimmungen zur IT-Sicherheit anzuwenden.
Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.
Prüfungsbereich
Kaufmännische Unterstützungsprozesse
Im Prüfungsbereich Kaufmännische Unterstützungsprozesse hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
- 1.
-
Instrumente des Rechnungswesens für die kaufmännische Planung, Steuerung und Kontrolle zu nutzen und Handlungsvorschläge abzuleiten,
- 2.
-
Vertrags- und Finanzierungsarten zu unterscheiden, Kunden und Kundinnen zu beraten und Verträge vorzubereiten,
- 3.
-
Beschaffungen von IT-Produkten und Dienstleistungen zu planen und durchzuführen sowie
- 4.
-
die Leistungserbringung zu kontrollieren und zu dokumentieren.
Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.
Prüfungsbereich
Wirtschafts- und Sozialkunde
Im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist, allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu beurteilen.
Die Prüfungsaufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu bearbeiten.
Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.
Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprüfung
Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewichten:
- 1.
-
Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzesmit 20 Prozent,
- 2.
-
Digitale Entwicklung von Prozessenmit 50 Prozent,
- 3.
-
Entwicklung eines digitalen Geschäftsmodellsmit 10 Prozent,
- 4.
-
Kaufmännische Unterstützungsprozessemit 10 Prozent sowie
- 5.
-
Wirtschafts- und Sozialkundemit 10 Prozent.
Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen – auch unter Berücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 16 – wie folgt bewertet worden sind:
- 1.
-
im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
- 2.
-
im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
- 3.
-
in mindestens drei Prüfungsbereichen von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“ und
- 4.
-
in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenügend“.
Mündliche Ergänzungsprüfung
Der Prüfling kann in einem Prüfungsbereich eine mündliche Ergänzungsprüfung beantragen.
Dem Antrag ist stattzugeben,
- 1.
-
wenn er für einen der folgenden Prüfungsbereiche gestellt worden ist:
- a)
-
Entwicklung eines digitalen Geschäftsmodells,
- b)
-
Kaufmännische Unterstützungsprozesse oder
- c)
-
Wirtschafts- und Sozialkunde,
- 2.
-
wenn der benannte Prüfungsbereich schlechter als mit „ausreichend“ bewertet worden ist und
- 3.
-
wenn die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen der Abschlussprüfung den Ausschlag geben kann.
Die mündliche Ergänzungsprüfung darf nur in einem einzigen Prüfungsbereich durchgeführt werden.
Die mündliche Ergänzungsprüfung soll 15 Minuten dauern.
Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2:1 zu gewichten.
Schlussvorschriften
Bestehende Berufsausbildungsverhältnisse
Berufsausbildungsverhältnisse zum Informatikkaufmann/zur Informatikkauffrau sowie zum Informations- und Telekommunikationssystem-Kaufmann/zur Informations- und Telekommunikationssystem-Kauffrau, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung bereits bestehen, können nach den Vorschriften dieser Verordnung unter Anrechnung der bisher absolvierten Ausbildungszeit fortgesetzt werden, wenn die Vertragsparteien dies vereinbaren und der oder die Auszubildende noch nicht die Zwischenprüfung absolviert hat.
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. August 2020 in Kraft.
Der Bundesminister
für Wirtschaft und Energie
Nussbaum
(zu § 3 Absatz 1)
Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung zum Kaufmann für
Digitalisierungsmanagement und zur Kauffrau für Digitalisierungsmanagement
Abschnitt A: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
| Lfd. Nr. |
Teil des Ausbildungsberufsbildes |
Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten |
Zeitliche Richtwerte in Wochen im |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. bis 18. Monat |
19. bis 36. Monat |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Planen, Vorbereiten und Durchführen von Arbeitsaufgaben in Abstimmung mit den kundenspezifischen Geschäfts- und Leistungsprozessen (§ 4 Absatz 2 Nummer 1) |
|
12 | |
| 2 | Informieren und Beraten von Kunden und Kundinnen (§ 4 Absatz 2 Nummer 2) |
|
3 | |
|
2 | |||
| 3 | Beurteilen marktgängiger IT-Systeme und kundenspezifischer Lösungen (§ 4 Absatz 2 Nummer 3) |
|
10 | |
|
5 | |||
| 4 | Entwickeln, Erstellen und Betreuen von IT-Lösungen (§ 4 Absatz 2 Nummer 4) |
|
5 | |
|
7 | |||
| 5 | Durchführen und Dokumentieren von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 2 Nummer 5) |
|
4 | |
|
8 | |||
| 6 | Umsetzen, Integrieren und Prüfen von Maßnahmen zur IT-Sicherheit und zum Datenschutz (§ 4 Absatz 2 Nummer 6) |
|
6 | |
|
6 | |||
| 7 | Erbringen der Leistungen und Auftragsabschluss (§ 4 Absatz 2 Nummer 7) |
|
7 | |
| 8 | Analysieren von Arbeits-, Geschäfts- und Wertschöpfungsprozessen (§ 4 Absatz 2 Nummer 8) |
|
16 | |
| 9 | Ermitteln des Bedarfs an Informationen und Bereitstellen von Daten (§ 4 Absatz 2 Nummer 9) |
|
14 | |
| 10 | Digitale Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen (§ 4 Absatz 2 Nummer 10) |
|
||
|
18 |
|||
| 11 | Anbahnen und Gestalten von Verträgen (§ 4 Absatz 2 Nummer 11) |
|
2 | |
|
6 | |||
| 12 | Planen und Durchführen von Beschaffungen (§ 4 Absatz 2 Nummer 12) |
|
6 | |
| 13 | Anwenden von Instrumenten der kaufmännischen Steuerung und Kontrolle (§ 4 Absatz 2 Nummer 13) |
|
6 | |
| 14 | Umsetzen der Schutzziele der Datensicherheit (§ 4 Absatz 2 Nummer 14) |
|
6 | |
| 15 | Einhalten der Bestimmungen zum Datenschutz und zu weiteren Schutzrechten (§ 4 Absatz 2 Nummer 15) |
|
4 | |
Abschnitt B: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
| Lfd. Nr. |
Teil des Ausbildungsberufsbildes |
Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten |
Zeitliche Richtwerte in Wochen im |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. bis 18. Monat |
19. bis 36. Monat |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
|
||
| 2 | Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
|
während der gesamten Ausbildung |
|
| 3 | Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (§ 4 Absatz 3 Nummer 3) |
|
||
| 4 | Umweltschutz (§ 4 Absatz 3 Nummer 4) |
Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Einwirkungsbereich
beitragen, insbesondere
|
||
| 5 | Vernetztes Zusammenarbeiten unter Nutzung digitaler Medien (§ 4 Absatz 3 Nummer 5) |
|
3 | |
Rahmenlehrplan
für die Ausbildungsberufe
Fachinformatiker und Fachinformatikerin
IT-System-Elektroniker und IT-System-Elektronikerin
(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 13. Dezember 2019)
Vorbemerkungen
Dieser Rahmenlehrplan für den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule ist durch die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder beschlossen worden und mit der entsprechenden Ausbildungsordnung des Bundes (erlassen vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie oder dem sonst zuständigen Fachministerium im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung) abgestimmt.
Der Rahmenlehrplan baut grundsätzlich auf dem Niveau des Hauptschulabschlusses bzw. vergleichbarer Abschlüsse auf. Er enthält keine methodischen Festlegungen für den Unterricht. Der Rahmenlehrplan beschreibt berufsbezogene Mindestanforderungen im Hinblick auf die zu erwerbenden Abschlüsse.
Die Ausbildungsordnung des Bundes und der Rahmenlehrplan der Kultusministerkonferenz sowie die Lehrpläne der Länder für den berufsübergreifenden Lernbereich regeln die Ziele und Inhalte der Berufsausbildung. Auf diesen Grundlagen erwerben die Schülerinnen und Schüler den Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf sowie den Abschluss der Berufsschule.
Die Länder übernehmen den Rahmenlehrplan unmittelbar oder setzen ihn in eigene Lehrpläne um. Im zweiten Fall achten sie darauf, dass die Vorgaben des Rahmenlehrplanes zur fachlichen und zeitlichen Abstimmung mit der jeweiligen Ausbildungsordnung erhalten bleiben.
Bildungsauftrag der Berufsschule
Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen in der dualen Berufsausbildung einen gemeinsamen Bildungsauftrag.
Die Berufsschule ist dabei ein eigenständiger Lernort, der auf der Grundlage der Rahmenvereinbarung über die Berufsschule (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 12. März 2015 in der jeweils geltenden Fassung) agiert. Sie arbeitet als gleichberechtigter Partner mit den anderen an der Berufsausbildung Beteiligten zusammen und hat die Aufgabe, den Schülerinnen und Schülern die Stärkung berufsbezogener und berufsübergreifender Handlungskompetenz zu ermöglichen. Damit werden die Schülerinnen und Schüler zur Erfüllung der Aufgaben im Beruf sowie zur nachhaltigen Mitgestaltung der Arbeitswelt und der Gesellschaft in sozialer, ökonomischer, ökologischer und individueller Verantwortung, insbesondere vor dem Hintergrund sich wandelnder Anforderungen, befähigt. Das schließt die Förderung der Kompetenzen der jungen Menschen
- –
-
zur persönlichen und strukturellen Reflexion,
- –
-
zum verantwortungsbewussten und eigenverantwortlichen Umgang mit zukunftsorientierten Technologien, digital vernetzten Medien sowie Daten- und Informationssystemen,
- –
-
in berufs- und fachsprachlichen Situationen adäquat zu handeln,
- –
-
zum lebensbegleitenden Lernen sowie zur beruflichen und individuellen Flexibilität zur Bewältigung der sich wandelnden Anforderungen in der Arbeitswelt und Gesellschaft,
- –
-
zur beruflichen Mobilität in Europa und einer globalisierten Welt
ein.
Der Unterricht der Berufsschule basiert auf den für jeden staatlich anerkannten Ausbildungsberuf bundeseinheitlich erlassenen Ordnungsmitteln. Darüber hinaus gelten die für die Berufsschule erlassenen Regelungen und Schulgesetze der Länder.
Um ihren Bildungsauftrag zu erfüllen, muss die Berufsschule ein differenziertes Bildungsangebot gewährleisten, das
- –
-
in didaktischen Planungen für das Schuljahr mit der betrieblichen Ausbildung abgestimmte handlungsorientierte Lernarrangements entwickelt,
- –
-
einen Unterricht mit entsprechender individueller Förderung vor dem Hintergrund unterschiedlicher Erfahrungen, Fähigkeiten und Begabungen aller Schülerinnen und Schüler ermöglicht,
- –
-
ein individuelles und selbstorganisiertes Lernen in der digitalen Welt fördert,
- –
-
eine Förderung der bildungs-, berufs- und fachsprachlichen Kompetenz berücksichtigt,
- –
-
eine nachhaltige Entwicklung der Arbeits- und Lebenswelt und eine selbstbestimmte Teilhabe an der Gesellschaft unterstützt,
- –
-
für Gesunderhaltung und Unfallgefahren sensibilisiert,
- –
-
einen Überblick über die Bildungs- und beruflichen Entwicklungsperspektiven einschließlich unternehmerischer Selbstständigkeit aufzeigt, um eine selbstverantwortliche Berufs- und Lebensplanung zu unterstützen,
- –
-
an den relevanten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Ergebnissen im Hinblick auf Kompetenzentwicklung und Kompetenzfeststellung ausgerichtet ist.
Zentrales Ziel von Berufsschule ist es, die Entwicklung umfassender Handlungskompetenz zu fördern. Handlungskompetenz wird verstanden als die Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten.
Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz.
Fachkompetenz
Bereitschaft und Fähigkeit, auf der Grundlage fachlichen Wissens und Könnens Aufgaben und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen und das Ergebnis zu beurteilen.
Selbstkompetenz 1
Bereitschaft und Fähigkeit, als individuelle Persönlichkeit die Entwicklungschancen, Anforderungen und Einschränkungen in Familie, Beruf und öffentlichem Leben zu klären, zu durchdenken und zu beurteilen, eigene Begabungen zu entfalten sowie Lebenspläne zu fassen und fortzuentwickeln. Sie umfasst Eigenschaften wie Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein. Zu ihr gehören insbesondere auch die Entwicklung durchdachter Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte.
Sozialkompetenz
Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, Zuwendungen und Spannungen zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen. Hierzu gehört insbesondere auch die Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidarität.
Methodenkompetenz, kommunikative Kompetenz und Lernkompetenz sind immanenter Bestandteil von Fachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz.
Methodenkompetenz
Bereitschaft und Fähigkeit zu zielgerichtetem, planmäßigem Vorgehen bei der Bearbeitung von Aufgaben und Problemen (zum Beispiel bei der Planung der Arbeitsschritte).
Kommunikative Kompetenz
Bereitschaft und Fähigkeit, kommunikative Situationen zu verstehen und zu gestalten. Hierzu gehört es, eigene Absichten und Bedürfnisse sowie die der Partner wahrzunehmen, zu verstehen und darzustellen.
Lernkompetenz
Bereitschaft und Fähigkeit, Informationen über Sachverhalte und Zusammenhänge selbstständig und gemeinsam mit anderen zu verstehen, auszuwerten und in gedankliche Strukturen einzuordnen. Zur Lernkompetenz gehört insbesondere auch die Fähigkeit und Bereitschaft, im Beruf und über den Berufsbereich hinaus Lerntechniken und Lernstrategien zu entwickeln und diese für lebenslanges Lernen zu nutzen.
Didaktische Grundsätze
Um dem Bildungsauftrag der Berufsschule zu entsprechen werden die jungen Menschen zu selbstständigem Planen, Durchführen und Beurteilen von Arbeitsaufgaben im Rahmen ihrer Berufstätigkeit befähigt.
Lernen in der Berufsschule zielt auf die Entwicklung einer umfassenden Handlungskompetenz. Mit der didaktisch begründeten praktischen Umsetzung – zumindest aber der gedanklichen Durchdringung – aller Phasen einer beruflichen Handlung in Lernsituationen wird dabei Lernen in und aus der Arbeit vollzogen.
Handlungsorientierter Unterricht im Rahmen der Lernfeldkonzeption orientiert sich prioritär an handlungssystematischen Strukturen und stellt gegenüber vorrangig fachsystematischem Unterricht eine veränderte Perspektive dar. Nach lerntheoretischen und didaktischen Erkenntnissen sind bei der Planung und Umsetzung handlungsorientierten Unterrichts in Lernsituationen folgende Orientierungspunkte zu berücksichtigen:
- –
-
Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die Berufsausübung bedeutsam sind.
- –
-
Lernen vollzieht sich in vollständigen Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder zumindest gedanklich nachvollzogen.
- –
-
Handlungen fördern das ganzheitliche Erfassen der beruflichen Wirklichkeit in einer zunehmend globalisierten und digitalisierten Lebens- und Arbeitswelt (zum Beispiel ökonomische, ökologische, rechtliche, technische, sicherheitstechnische, berufs-, fach- und fremdsprachliche, soziale und ethische Aspekte).
- –
-
Handlungen greifen die Erfahrungen der Lernenden auf und reflektieren sie in Bezug auf ihre gesellschaftlichen Auswirkungen.
- –
-
Handlungen berücksichtigen auch soziale Prozesse, zum Beispiel die Interessenerklärung oder die Konfliktbewältigung, sowie unterschiedliche Perspektiven der Berufs- und Lebensplanung.
Berufsbezogene Vorbemerkungen
Der vorliegende Rahmenlehrplan für die Berufsausbildungen zum Fachinformatiker und zur Fachinformatikerin in den Fachrichtungen Anwendungsentwicklung, Systemintegration, Daten- und Prozessanalyse und Digitale Vernetzung sowie zum IT-System-Elektroniker und zur IT-System-Elektronikerin ist mit der Fachinformatikerausbildungsverordnung vom 28. Februar 2020 (BGBl. I S. 250) sowie der IT-System-Elektroniker-Ausbildungsverordnung vom 28. Februar 2020 (BGBl. I S. 268) abgestimmt.
Die Rahmenlehrpläne für die Ausbildungsberufe Fachinformatiker/Fachinformatikerin (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 25. April 1997) und Informations- und Telekommunikationssystem-Elektroniker/Informations- und Telekommunikationssystem-Elektronikerin (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 25. April 1997) werden durch den vorliegenden Rahmenlehrplan aufgehoben.
Die für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde erforderlichen Kompetenzen werden auf der Grundlage der „Elemente für den Unterricht der Berufsschule im Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde gewerblich-technischer Ausbildungsberufe“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 7. Mai 2008) vermittelt.
In Ergänzung des Berufsbildes (Bundesinstitut für Berufsbildung unter http://www.bibb.de) sind folgende Aspekte im Rahmen des Berufsschulunterrichtes bedeutsam:
Fachinformatiker und Fachinformatikerinnen und IT-System-Elektroniker und IT-System-Elektronikerinnen sind branchenübergreifend in unterschiedlichen Unternehmensbereichen eingesetzt, wodurch die Schwerpunkte der beruflichen Handlungsfelder deutlich divergieren können. Typische berufliche Handlungsfelder der technischen IT-Berufe sind die Erstellung von Anwendungen zum Umgang mit Daten, Arbeitsplätzen und digital vernetzten Systemen und die Übergabe an die Kunden. Je nach beruflichem Schwerpunkt werden dabei Neuentwicklungen von oder Modifikationen an Hardware und Software vorgenommen. Die Facharbeiter und Facharbeiterinnen kommunizieren im technischen Support sowie bei der Beratung, Inbetriebnahme und Übergabe mit Kunden und Mitarbeitern adressatengerecht. Bei der fortschreitenden digitalen Vernetzung, dem Aufbau und der Entwicklung von cyber-physischen Systemen und der Implementierung vom maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz in Anwendungen und Systemen arbeiten beiden Berufe, sowie die Fachrichtungen eng verzahnt miteinander und mit den kaufmännischen IT-Berufen zusammen.
Fachinformatiker und Fachinformatikerinnen in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung haben ihren Schwerpunkt in der Projektierung und Entwicklung von Softwarelösungen unter Berücksichtigung der Informationssicherheit. Entwicklungsprozesse finden mit agilen, vernetzen und multidisziplinären Methoden statt. Zudem werden für das jeweilige Projekt angemessene Programmierparadigmen, -sprachen und -umgebungen ausgewählt.
Fachinformatiker und Fachinformatikerinnen in der Fachrichtung Systemintegration haben ihren Schwerpunkt bei der Planung, Installation, Konfiguration, Inbetriebnahme und Verwaltung vernetzter Systeme. Dabei werden diese Systeme unter Berücksichtigung der Informationssicherheit entwickelt, modifiziert und betrieben, Dienste implementiert sowie Störungen eingegrenzt und behoben.
Fachinformatiker und Fachinformatikerinnen in der Fachrichtung Daten- und Prozessanalyse haben ihren Schwerpunkt in der Entwicklung von Systemen maschinellen Lernens, der Analyse von Prozessen und Daten zur Optimierung von digitalen Geschäftsprozessen und der Einbindung neuer digitaler Geschäftsmodelle, jeweils unter Berücksichtigung der Informationssicherheit.
Fachinformatiker und Fachinformatikerinnen in der Fachrichtung Digitale Vernetzung haben ihren Schwerpunkt in der Entwicklung, Inbetriebnahme und dem Support von digital vernetzten Prozessen, Anwendungen und Produkten unter Berücksichtigung der Informationssicherheit. Dabei werden cyber-physische Systeme, sowie deren Software neu erstellt oder vorhandene Systeme miteinander zu neuen Lösungen kombiniert und vernetzt.
IT-System-Elektroniker und IT-System-Elektronikerinnen haben ihren Schwerpunkt bei der Planung, Konfiguration und Inbetriebnahme von Systemen und deren Stromversorgung. Sie unterstützen bei der Erstellung kundenspezifischer cyber-physischer und digital vernetzter Systeme durch Modifikation der Hardware und Anpassung der Software sowie beim technischen Support dieser Systeme, jeweils unter Berücksichtigung der Informationssicherheit.
Die Lernfelder orientieren sich an diesen beruflichen Handlungsfeldern. Sie sind methodisch-didaktisch so umzusetzen, dass sie zu einer umfassenden beruflichen Handlungskompetenz führen. Diese umfasst insbesondere fundiertes Fachwissen, kommunikative Fähigkeiten, vernetztes und analytisches Denken, Eigeninitiative, Empathie und Teamfähigkeit. Angesichts der kurzen Innovationszyklen im Bereich der Entwicklungsmethoden, technischen Treibern und Anwendungen benötigen IT-Berufe ein hohes Maß an Selbstorganisation und Lernkompetenz.
Die in den Lernfeldern formulierten Kompetenzen beschreiben den Qualifikationsstand am Ende des Lernprozesses und stellen den Mindestumfang dar. Inhalte sind in Kursivschrift nur dann aufgeführt, wenn die in den Zielformulierungen beschriebenen Kompetenzen konkretisiert oder eingeschränkt werden sollen. Die Lernfelder bauen spiralcurricular aufeinander auf.
Der Kompetenzerwerb im Kontext der digitalen Arbeits- und Geschäftsprozesse ist integrativer Bestandteil der Fachkompetenzen und entfaltet sich darüber hinaus in überfachlichen Kompetenzdimensionen. Die Nutzung von informationstechnischen Systemen und der Einsatz von digitalen Medien sind integrierte Bestandteile der Lernfelder und im Unterricht der IT-Berufe besonders ausgeprägt. Bei entsprechender Relevanz werden sie in einzelnen Lernfeldern gesondert ausgewiesen.
Der Erwerb von Fremdsprachenkompetenz ist in den Lernfeldern integriert.
In den Lernfeldern werden die Dimensionen der Nachhaltigkeit – Ökonomie, Energieeffizienz, Ökologie und Soziales –, des wirtschaftlichen Denkens, der soziokulturellen Unterschiede und der selbstbestimmten Teilhabe an der Gesellschaft berücksichtigt. Bei den IT-Berufen liegt zudem ein besonderes Augenmerk auf ethische Implikationen, welche sich beim Einsatz von autonomen Systemen und im Umgang mit sensiblen Daten aus dem Data-Mining ergeben.
Im Ausbildungsberuf IT-System-Elektroniker und IT-System-Elektronikerinnen beginnt die Förderung von Kompetenzen zur Anbindung von IT-Systemen an die Stromversorgung bereits in Lernfeld 2. Hierbei bilden Maßnahmen zum Schutz gegen elektrische Gefährdung, Energiebedarf und Leitungsdimensionierung einen Schwerpunkt. Die Förderung von Kompetenzen im Fachbereich Elektrotechnik wird in den weiteren Ausbildungsjahren insbesondere in den Lernfeldern 7, 10 und 11 fortgesetzt.
Praxis- und berufsbezogene Lernsituationen nehmen eine zentrale Stellung in der Unterrichtsgestaltung ein. Die Branchenvielfalt sollte dabei berücksichtigt werden. Im Rahmenlehrplan wird die Bezeichnung „Kunden“ für firmenintern sowie extern auftraggebende Personen oder Gruppen verwendet. Unter IT-Systemen wird im Zusammenhang mit dem Rahmenlehrplan jegliche Art elektronischer datenverarbeitender Systeme verstanden, die zur Lösung bestehender Probleme mit der hierfür benötigten Software, Hardware und zugehörigen Dienstleistungen eingesetzt werden können. Die Erweiterung zu vernetzten Systemen beinhaltet die cyber-physischen Komponenten, welche erst durch die Erschließung mittels Hard- und Software zu einem IT-System wird.
Beide technischen IT-Berufe haben mit den kaufmännischen IT-Berufen (Kaufleute für Digitalisierungsmanagement und Kaufleute für IT-System-Management) eine gemeinsame Basis berufsübergreifender Kompetenzen. Diese werden vorwiegend im ersten Ausbildungsjahr erworben. Deshalb besteht die Möglichkeit einer gemeinsamen Beschulung im ersten Ausbildungsjahr der IT-Berufe, da die Lernfelder 1 bis 5 in den jeweiligen Rahmenlehrplänen identisch formuliert sind. Im zweiten Ausbildungsjahr trifft dies auch für das Lernfeld 6 zu.
Zudem sind bei den Fachinformatikern und Fachinformatikerinnen und den IT-System-Elektronikerinnen und IT-System-Elektronikern die Lernfelder 7 bis 9 auf den gleichen Kompetenzen aufgebaut.
Die Fachinformatiker und Fachinformatikerinnen in den Fachrichtungen Systemintegration und Digitale Vernetzung sowie die IT-System-Elektroniker und IT-System-Elektronikerinnen erwerben ferner im Lernfeld 11 (b, d und SE) gleiche Kompetenzen. Im Fall einer gemeinsamen Beschulung sollten die jeweiligen berufstypischen Anforderungen durch Binnendifferenzierung berücksichtigt werden.
Die Lernfelder 10a und 11a der Fachinformatiker und Fachinformatikerinnen in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung sollten aufeinander aufbauend unterrichtet werden.
Aufgrund ihrer Prüfungsrelevanz sind die Lernfelder 1 bis 6 des Rahmenlehrplans vor Teil 1 der Abschlussprüfung zu unterrichten.
Lernfelder
|
Übersicht über die Lernfelder für die Ausbildungsberufe
Fachinformatiker und Fachinformatikerin IT-System-Elektroniker und IT-System-Elektronikerin |
||||
|---|---|---|---|---|
| Lernfelder |
Zeitrichtwerte in Unterrichtsstunden |
|||
| Nr. | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | |
| 1 | Das Unternehmen und die eigene Rolle im Betrieb beschreiben | 40 | ||
| 2 | Arbeitsplätze nach Kundenwunsch ausstatten | 80 | ||
| 3 | Clients in Netzwerke einbinden | 80 | ||
| 4 | Schutzbedarfsanalyse im eigenen Arbeitsbereich durchführen | 40 | ||
| 5 | Software zur Verwaltung von Daten anpassen | 80 | ||
| 6 | Serviceanfragen bearbeiten | 40 | ||
| 7 | Cyber-physische Systeme ergänzen | 80 | ||
| 8 | Daten systemübergreifend bereitstellen | 80 | ||
| 9 | Netzwerke und Dienste bereitstellen | 80 | ||
| Fachinformatiker und Fachinformatikerin in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung | ||||
| 10a | Benutzerschnittstellen gestalten und entwickeln | 80 | ||
| 11a | Funktionalität in Anwendungen realisieren | 80 | ||
| 12a | Kundenspezifische Anwendungsentwicklung durchführen | 120 | ||
| Fachinformatiker und Fachinformatikerin in der Fachrichtung Systemintegration | ||||
| 10b | Serverdienste bereitstellen und Administrationsaufgaben automatisieren | 80 | ||
| 11b | Betrieb und Sicherheit vernetzter Systeme gewährleisten | 80 | ||
| 12b | Kundenspezifische Systemintegration durchführen | 120 | ||
| Fachinformatiker und Fachinformatikerin in der Fachrichtung Daten- und Prozessanalyse | ||||
| 10c | Werkzeuge des maschinellen Lernens einsetzen | 80 | ||
| 11c | Prozesse analysieren und gestalten | 80 | ||
| 12c | Kundenspezifische Prozess- und Datenanalyse durchführen | 120 | ||
| Fachinformatiker und Fachinformatikerin in der Fachrichtung Digitale Vernetzung | ||||
| 10d | Cyber-physische Systeme entwickeln | 80 | ||
| 11d | Betrieb und Sicherheit vernetzter Systeme gewährleisten | 80 | ||
| 12d | Kundenspezifisches cyber-physisches System optimieren | 120 | ||
| Summen: insgesamt 880 Stunden | 320 | 280 | 280 | |
| IT-System-Elektroniker und IT-System-Elektronikerin | ||||
| 10 (SE) | Energieversorgung bereitstellen und die Betriebssicherheit gewährleisten | 80 | ||
| 11 (SE) | Betrieb und Sicherheit vernetzter Systeme gewährleisten | 80 | ||
| 12 (SE) | Instandhaltung planen und durchführen | 120 | ||
| Summen: insgesamt 880 Stunden | 320 | 280 | 280 | |
| Lernfeld 1: | Das Unternehmen und die eigene Rolle im Betrieb beschreiben |
1. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 40 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, ihr Unternehmen hinsichtlich
seiner Wertschöpfungskette zu präsentieren und ihre eigene Rolle im Betrieb zu beschreiben.
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich, auch anhand des Unternehmensleitbildes, über die ökonomischen, ökologischen und sozialen Zielsetzungen des Unternehmens. Sie analysieren die Marktstruktur in ihrer Branche und ordnen das Unternehmen als komplexes System mit seinen Markt- und Kundenbeziehungen ein. Sie beschreiben die Wertschöpfungskette und ihre eigene Rolle im Betrieb. Dabei erkunden sie die Leistungsschwerpunkte sowie Besonderheiten ihres Unternehmens und setzen sich mit der Organisationsstruktur (Aufbauorganisation) und Rechtsform auseinander. Sie informieren sich über den eigenen Handlungs- und Entscheidungsspielraum im Unternehmen (Vollmachten) sowie über Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Sie planen und erstellen, auch im Team, adressatengerecht multimediale Darstellungen zu ihrem Unternehmen. Die Schülerinnen und Schüler präsentieren ihre Ergebnisse. Sie überprüfen kriteriengeleitet die Qualität ihres Handlungsproduktes und entwickeln gemeinsam Verbesserungsmöglichkeiten. Sie reflektieren die eigene Rolle und das eigene Handeln im Betrieb. |
||
| Lernfeld 2: | Arbeitsplätze nach Kundenwunsch ausstatten |
1. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 80 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, die Ausstattung eines Arbeitsplatzes
nach Kundenwunsch zu dimensionieren, anzubieten, zu beschaffen und den Arbeitsplatz
an die Kunden zu übergeben.
Die Schülerinnen und Schüler nehmen den Kundenwunsch für die Ausstattung eines Arbeitsplatzes von internen und externen Kunden entgegen und ermitteln die sich daraus ergebenden Anforderungen an Soft- und Hardware. Aus den dokumentierten Anforderungen leiten sie Auswahlkriterien für die Beschaffung ab. Sie berücksichtigen dabei die Einhaltung von Normen und Vorschriften (Zertifikate, Kennzeichnung) für den Betrieb und die Sicherheit von elektrischen Geräten und Komponenten. Sie vergleichen die technischen Merkmale relevanter Produkte anhand von Datenblättern und Produktbeschreibungen zur Vorbereitung einer Auswahlentscheidung (Nutzwertanalyse). Dabei beachten sie insbesondere informationstechnische und energietechnische Kenngrößen sowie Aspekte der Ergonomie und der Nachhaltigkeit (Umweltschutz, Recycling). Sie wenden Recherchemethoden an und werten auch fremdsprachliche Quellen aus. Sie ermitteln die Energieeffizienz unterschiedlicher Arbeitsplatzvarianten und dokumentieren diese. Sie vergleichen mögliche Bezugsquellen (quantitativer und qualitativer Angebotsvergleich) und bestimmen den Lieferanten. Auf Basis der ausgewählten Produkte und Lieferanten erstellen sie mit vorgegebenen Zuschlagssätzen ein Angebot für die Kunden. Sie schließen den Kaufvertrag ab und organisieren den Beschaffungsprozess unter Berücksichtigung von Lieferzeiten. Sie nehmen die bestellten Komponenten in Empfang und dokumentieren dabei festgestellte Mängel. Sie bereiten die Übergabe der beschafften Produkte vor, integrieren IT-Komponenten, konfigurieren diese und nehmen sie unter Berücksichtigung der Arbeitssicherheit in Betrieb. Sie übergeben den Arbeitsplatz an die Kunden und erstellen ein Übergabeprotokoll. Sie bewerten die Durchführung des Kundenauftrags und reflektieren ihr Vorgehen. Dabei berücksichtigen sie die Kundenzufriedenheit und formulieren Verbesserungsvorschläge. |
||
| Lernfeld 3: | Clients in Netzwerke einbinden |
1. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 80 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, eine Netzwerkinfrastruktur
zu analysieren sowie Clients zu integrieren.
Die Schülerinnen und Schüler erfassen im Kundengespräch die Anforderungen an die Integration von Clients (Soft- und Hardware) in eine bestehende Netzwerkinfrastruktur und leiten Leistungskriterien ab. Sie informieren sich über Strukturen und Komponenten des Netzwerkes und erfassen deren Eigenschaften und Standards. Dazu verwenden sie technische Dokumente, auch in fremder Sprache. Sie nutzen physische sowie logische Netzwerkpläne und beachten betriebliche Sicherheitsvorgaben. Sie planen die Integration in die bestehende Netzwerkinfrastruktur indem sie ein anforderungsgerechtes Konzept auch unter ökologischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten (Energieeffizienz) erstellen. Sie führen auf der Basis der Leistungskriterien die Auswahl von Komponenten durch. Sie konfigurieren Clients und binden diese in das Netzwerk ein. Sie prüfen systematisch die Funktion der konfigurierten Clients im Netzwerk und protokollieren das Ergebnis. Sie reflektieren den Arbeitsprozess hinsichtlich möglicher Optimierungen und diskutieren das Ergebnis in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Ökologie. |
||
| Lernfeld 4: | Schutzbedarfsanalyse im eigenen Arbeitsbereich durchführen |
1. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 40 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, mit Hilfe einer bestehenden
Sicherheitsleitlinie eine Schutzbedarfsanalyse zur Ermittlung der Informationssicherheit
auf Grundschutzniveau in ihrem Arbeitsbereich durchzuführen.
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über Informationssicherheit (Schutzziele) und rechtliche Regelungen sowie die Einhaltung von betrieblichen Vorgaben zur Bestimmung des Schutzniveaus für den eigenen Arbeitsbereich. Sie planen eine Schutzbedarfsanalyse, indem sie gemäß der IT-Sicherheitsleitlinie des Unternehmens Schutzziele des Grundschutzes (Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit) in ihrem Arbeitsbereich ermitteln und eine Klassifikation von Schadensszenarien vornehmen. Sie entscheiden über die Gewichtung möglicher Bedrohungen unter Berücksichtigung der Schadenszenarien. Dazu führen sie eine Schutzbedarfsanalyse in ihrem Arbeitsbereich durch, nehmen Bedrohungsfaktoren auf und dokumentieren diese. Die Schülerinnen und Schüler bewerten die Ergebnisse der Schutzbedarfsanalyse und gleichen diese mit der IT-Sicherheitsleitlinie des Unternehmens ab. Sie empfehlen Maßnahmen und setzen diese im eigenen Verantwortungsbereich um. Sie reflektieren den Arbeitsablauf und übernehmen Verantwortung im IT-Sicherheitsprozess. |
||
| Lernfeld 5: | Software zur Verwaltung von Daten anpassen |
1. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 80 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Informationen mittels Daten
abzubilden, diese Daten zu verwalten und dazu Software anzupassen.
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich innerhalb eines Projektes über die Abbildung von Informationen mittels Daten. Dabei analysieren sie Daten hinsichtlich Herkunft, Art, Verfügbarkeit, Datenschutz, Datensicherheit und Speicheranforderung und berücksichtigen Datenformate und Speicherlösungen. Sie planen die Anpassung einer Anwendung zur Verwaltung der Datenbestände und entwickeln Testfälle. Dabei entscheiden sie sich für ein Vorgehen. Die Schülerinnen und Schüler implementieren die Anpassung der Anwendung, auch im Team und erstellen eine Softwaredokumentation. Sie testen die Funktion der Anwendung und beurteilen deren Eignung zur Bewältigung der gestellten Anforderungen. Sie evaluieren den Prozess der Softwareentwicklung. |
||
| Lernfeld 6: | Serviceanfragen bearbeiten |
1. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 40 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Serviceanfragen einzuordnen,
Fehlerursachen zu ermitteln und zu beheben.
Die Schülerinnen und Schüler nehmen Serviceanfragen entgegen (direkter und indirekter Kundenkontakt). Sie analysieren Serviceanfragen und prüfen deren vertragliche Grundlage (Service-Level-Agreement). Sie ermitteln die Reaktionszeit und dokumentieren den Status der Anfragen im zugrunde liegenden Service-Management-System. Durch systematisches Fragen ordnen die Schülerinnen und Schüler Serviceanfragen unter Berücksichtigung des Support-Levels und fachlicher Standards ein. Sie ermitteln Lösungsmöglichkeiten im Rahmen des Support-Levels. Auf dieser Basis bearbeiten sie das Problem und dokumentieren den Bearbeitungsstatus. Sie kommunizieren mit den Prozessbeteiligten situationsgerecht, auch in einer Fremdsprache, und passen sich den unterschiedlichen Kommunikationsanforderungen an (Kommunikationsmodelle, Deeskalationsstrategien). Sie reflektieren den Bearbeitungsprozess der Serviceanfragen und ihr Verhalten in Gesprächssituationen. Die Schülerinnen und Schüler diskutieren die Servicefälle und schlagen Maßnahmen zur Qualitätssteigerung vor. |
||
| Lernfeld 7: | Cyber-physische Systeme ergänzen |
2. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 40 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, die physische Welt und IT-Systeme
funktional zu einem cyber-physischen System zusammenzuführen.
Die Schülerinnen und Schüler analysieren ein cyber-physisches System bezüglich eines Kundenauftrags zur Ergänzung und Inbetriebnahme weiterer Komponenten. Sie informieren sich über den Datenfluss an der Schnittstelle zwischen physischer Welt und IT-System sowie über die Kommunikation in einem bestehenden Netzwerk. Sie verschaffen sich einen Überblick über die Energie-, Stoff- und Informationsflüsse aller am System beteiligten Geräte und Betriebsmittel. Die Schülerinnen und Schüler planen die Umsetzung des Kundenwunsches, indem sie Kriterien für die Auswahl von Energieversorgung, Hardware und Software (Bibliotheken, Protokolle) aufstellen. Dazu nutzen sie Unterlagen der technischen Kommunikation und passen diese an. Sie führen Komponenten mit dem cyber-physischen System funktional zusammen. Sie prüfen systematisch die Funktion, messen physikalische Betriebswerte, validieren den Energiebedarf und protokollieren die Ergebnisse. Die Schülerinnen und Schüler reflektieren den Arbeitsprozess hinsichtlich möglicher Optimierungen und diskutieren das Ergebnis in Bezug auf Betriebssicherheit und Datensicherheit. |
||
| Lernfeld 8: | Daten systemübergreifend bereitstellen |
2. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 80 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Daten aus dezentralen Quellen
zusammenzuführen, aufzubereiten und zur weiteren Nutzung zur Verfügung zu stellen.
Die Schülerinnen und Schüler ermitteln für einen Kundenauftrag Datenquellen und analysieren diese hinsichtlich ihrer Struktur, rechtlicher Rahmenbedingungen, Zugriffsmöglichkeiten und -mechanismen. Sie wählen die Datenquellen (heterogen) für den Kundenauftrag aus. Sie entwickeln Konzepte zur Bereitstellung der gewählten Datenquellen für die weitere Verarbeitung unter Beachtung der Informationssicherheit. Die Schülerinnen und Schüler implementieren arbeitsteilig, auch ortsunabhängig, ihr Konzept mit vorhandenen sowie dazu passenden Entwicklungswerkzeugen und Produkten. Sie übergeben ihr Endprodukt mit Dokumentation zur Handhabung, auch in fremder Sprache, an die Kunden. Sie reflektieren die Eignung der eingesetzten Entwicklungswerkzeuge hinsichtlich des arbeitsteiligen Entwicklungsprozesses und die Qualität der Dokumentation. |
||
| Lernfeld 9: | Netzwerke und Dienste bereitstellen |
2. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 80 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Netzwerke und Dienste zu
planen, zu konfigurieren und zu erweitern.
Die Schülerinnen und Schüler ermitteln die Anforderungen an ein Netzwerk in Kommunikation mit den Kunden. Sie informieren sich über Eigenschaften, Funktionen und Leistungsmerkmale der Netzwerkkomponenten und Dienste nach Kundenanforderung, auch unter Berücksichtigung sicherheitsrelevanter Merkmale. Dabei wenden sie Recherchemethoden an und werten auch fremdsprachliche Quellen aus. Sie planen die erforderlichen Dienste und dafür notwendige Netzwerke sowie deren Infrastruktur unter Berücksichtigung interner und externer Ressourcen. Dazu vergleichen sie Konzepte hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit sowie der technischen und wirtschaftlichen Eignung. Sie installieren und konfigurieren Netzwerke sowie deren Infrastruktur und implementieren Dienste. Sie gewährleisten die Einhaltung von Standards, führen Funktionsprüfungen sowie Messungen durch und erstellen eine Dokumentation. Die Schülerinnen und Schüler beurteilen die Netzwerke sowie deren Infrastruktur und die Dienste hinsichtlich der gestellten Anforderungen, Datensicherheit und Datenschutz. Sie reflektieren ihre Lösung unter Berücksichtigung der Kundenzufriedenheit, Zukunftsfähigkeit und Vorgehensweise. |
||
Fachinformatiker und Fachinformatikerin in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung
| Lernfeld 10a: | Benutzerschnittstellen gestalten und entwickeln |
3. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 80 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Benutzeroberflächen für
softwarebasierte Arbeitsabläufe und Geschäftsprozesse zu gestalten und zu entwickeln.
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über die vorhandenen betrieblichen Abläufe und Geschäftsprozesse. Sie stellen diese modellhaft dar und leiten Optimierungsmöglichkeiten ab. Sie gestalten und entwickeln mit agilen Methoden die Benutzeroberflächen für unterschiedliche Endgeräte und Betriebssysteme und stellen die vollständige Abbildung des Informationsflusses unter Berücksichtigung der Prozessbeschreibung sicher. Die Schülerinnen und Schüler stellen die Funktionalität der Softwarelösung her und nutzen hierzu bereits vorhandene Bibliotheken und Module. Sie überprüfen das Produkt auf Datenschutzkonformität und Benutzerfreundlichkeit. Die Schülerinnen und Schüler testen die funktionale Richtigkeit. Sie quantifizieren die Reduktion der Prozesskosten des digitalisierten, optimierten Geschäftsprozesses und stellen diese den Entwicklungskosten gegenüber. |
||
| Lernfeld 11a: | Funktionalität in Anwendungen realisieren |
3. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 80 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, modulare Komponenten zur
informationstechnischen Verarbeitung von Arbeitsabläufen und Geschäftsprozessen zu
entwickeln und deren Qualität zu sichern.
Die Schülerinnen und Schüler leiten aus den Informationsobjekten der vorgegebenen Prozessbeschreibungen der Kunden die dazu notwendigen Datenstrukturen und Funktionalitäten ab. Sie planen modulare Softwarekomponenten und beschreiben deren Funktionsweise mit Diagrammen und Modellen. Sie wählen eine Methode zur Softwareentwicklung aus. Dabei beachten sie, dass Planung, Realisierung und Tests iterativ in Abstimmung mit den Kunden erfolgen. Die Schülerinnen und Schüler realisieren, auch im Team, die Softwarekomponenten und binden diese an Datenquellen an. Sie dokumentieren die Schnittstellen. Sie testen die erforderliche Funktionalität, indem sie Testfälle formulieren und automatisierte Testverfahren anwenden. Die Schülerinnen und Schüler beurteilen die Funktionalität anhand festgelegter Kriterien der Kunden und leiten Maßnahmen zur Überarbeitung der erstellten Module ein. |
||
| Lernfeld 12a: | Kundenspezifische Anwendungsentwicklung durchführen |
3. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 120 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, einen Kundenauftrag zur
Anwendungsentwicklung vollständig durchzuführen und zu bewerten.
Die Schülerinnen und Schüler führen in Zusammenarbeit mit den Kunden eine Anforderungsanalyse durch und leiten daraus Projektziele, Anforderungen, gewünschte Ergebnisse, Schulungsbedarfe und Rahmenbedingungen ab. Auf dieser Basis planen und kalkulieren sie ein Projekt mit den dazugehörigen personellen und technischen Ressourcen. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Lösungsvarianten, vergleichen diese anhand festgelegter Kriterien sowie unter Berücksichtigung von Datenschutz und Datensicherheit. Sie wählen mit den Kunden die beste Lösung aus. Für den vereinbarten Auftrag erstellen sie ein Dokument über die zu erbringenden Leistungen und ein Angebot. Die Schülerinnen und Schüler implementieren die gewünschte Lösung. Dabei nutzen sie Maßnahmen zur Qualitätssicherung. Sie präsentieren den Kunden das Projektergebnis und führen eine Schulung durch. Sie übergeben den Kunden das Produkt sowie die Dokumentation. Die Schülerinnen und Schüler bewerten das Projektergebnis auch hinsichtlich Zielerreichung, Wirtschaftlichkeit, Skalierbarkeit und Verlässlichkeit. Sie reflektieren die Projektdurchführung und das Projektergebnis auch unter Berücksichtigung der kritisch-konstruktiven Kundenrückmeldungen. |
||
Fachinformatiker und Fachinformatikerin in der Fachrichtung Systemintegration
| Lernfeld 10b: | Serverdienste bereitstellen und Administrationsaufgaben automatisieren |
3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Serverdienste bereitzustellen,
zu administrieren und zu überwachen.
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über Serverdienste sowie Plattformen. Sie wählen diese gemäß den Kundenanforderungen aus. Dabei berücksichtigen sie auch Verfügbarkeit, Skalierbarkeit, Administrierbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit. Sie planen die Konfiguration der ausgewählten Dienste und erstellen Konzepte zur Einrichtung, Aktualisierung, Datensicherung und Überwachung. Sie implementieren die Dienste unter Berücksichtigung betrieblicher Vorgaben und Lizenzierungen. Sie wenden Testverfahren an, überwachen die Dienste und empfehlen den Kunden Maßnahmen bei kritischen Zuständen. Sie dokumentieren ihre Ergebnisse. Sie automatisieren Administrationsprozesse in Abhängigkeit kundenspezifischer Rahmenbedingungen, testen und optimieren die Automatisierung. Die Schülerinnen und Schüler reflektieren ihre Lösung und beurteilen sie hinsichtlich der Kundenanforderungen. |
||
| Lernfeld 11b: | Betrieb und Sicherheit vernetzter Systeme gewährleisten |
3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, mit Hilfe einer Risikoanalyse
den Schutzbedarf eines vernetzten Systems zu ermitteln und Schutzmaßnahmen zu planen,
umzusetzen und zu dokumentieren.
Die Schülerinnen und Schüler bereiten sich auf ein Kundengespräch zur Identifizierung eines Schutzbedarfes vor. Hierzu informieren sie sich über Informationssicherheit in vernetzten Systemen. Sie ermitteln im Kundengespräch die Schutzziele, analysieren die Systeme hinsichtlich der Anforderungen an die Informationssicherheit und benennen Risiken. Die Schülerinnen und Schüler planen unter Beachtung betrieblicher IT-Sicherheitsleitlinien und rechtlicher Regelungen die Vorkehrungen und Maßnahmen zur Minimierung der Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts. Sie implementieren die Maßnahmen unter Berücksichtigung technischer und organisatorischer Rahmenbedingungen. Sie prüfen die Sicherheit des vernetzten Systems und bewerten das erreichte Sicherheitsniveau in Bezug auf die Kundenanforderungen, eingesetzter Maßnahmen und Wirtschaftlichkeit. Sie erstellen eine Dokumentation und informieren die Kunden über die Ergebnisse der Risikoanalyse. Die Schülerinnen und Schüler reflektieren den Arbeitsprozess hinsichtlich möglicher Optimierungen und diskutieren das Ergebnis in Bezug auf den Begriff der relativen Sicherheit des vernetzten Systems. |
||
| Lernfeld 12b: | Kundenspezifische Systemintegration durchführen |
3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 120 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, einen Kundenauftrag zur
Systemintegration vollständig durchzuführen und zu bewerten.
Die Schülerinnen und Schüler führen in Zusammenarbeit mit den Kunden eine Anforderungsanalyse durch und leiten daraus Projektziele, Anforderungen, gewünschte Ergebnisse, Schulungsbedarfe und Rahmenbedingungen ab. Auf dieser Basis planen und kalkulieren sie ein Projekt mit den dazugehörigen personellen und technischen Ressourcen. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Lösungsvarianten, vergleichen diese anhand festgelegter Kriterien sowie unter Berücksichtigung von Datenschutz und Datensicherheit. Sie wählen mit den Kunden die beste Lösung aus. Für den vereinbarten Auftrag erstellen sie ein Dokument über die zu erbringenden Leistungen und ein Angebot. Die Schülerinnen und Schüler implementieren die gewünschte Lösung. Dabei nutzen sie Maßnahmen zur Qualitätssicherung. Sie präsentieren den Kunden das Projektergebnis und führen eine Schulung durch. Sie übergeben den Kunden das Produkt sowie die Dokumentation. Die Schülerinnen und Schüler bewerten das Projektergebnis auch hinsichtlich Zielerreichung, Wirtschaftlichkeit, Skalierbarkeit und Verlässlichkeit. Sie reflektieren die Projektdurchführung und das Projektergebnis auch unter Berücksichtigung der kritisch-konstruktiven Kundenrückmeldungen. |
||
Fachinformatiker und Fachinformatikerin in der Fachrichtung Daten- und Prozessanalyse
| Lernfeld 10c: | Werkzeuge des maschinellen Lernens einsetzen |
3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, maschinelles Lernen zur
Problemlösung anzuwenden und den Lernfortschritt des Entscheidungssystems zu begleiten.
Die Schülerinnen und Schüler stellen Einsatzmöglichkeiten des maschinellen Lernens dar. Auf dieser Basis entscheiden sie über die betriebswirtschaftlich sinnvolle Eignung maschinellen Lernens bezüglich kundenspezifischer Problemstellungen. Sie führen die benötigten Daten zusammen. Dazu analysieren sie freie und kommerzielle Datenquellen und wählen diese nach Eignung zur Lösung der Aufgabe durch maschinelles Lernen aus. Die Schülerinnen und Schüler berücksichtigen datenschutzrechtliche, moralische und wirtschaftliche Aspekte. Sie legen für die Aufgabenstellung maschinellen Lernens adäquate Werkzeuge und Systeme fest. Sie bereiten das ausgewählte System technisch vor und implementieren die Schnittstellen zum Datenimport. Die Schülerinnen und Schüler überwachen die technische Funktionsfähigkeit im Hinblick auf den Lernfortschritt des Systems. Sie reflektieren die Wirksamkeit des angelernten Entscheidungssystems. Dabei diskutieren sie auch datenschutzrechtliche, moralische und wirtschaftliche Aspekte. |
||
| Lernfeld 11c: | Prozesse analysieren und gestalten |
3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, durch Prozess- und Datenanalyse
digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln.
Die Schülerinnen und Schüler leiten aus einer kundenspezifischen Prozessdarstellung den zur Digitalisierung des Prozesses benötigten Informationsfluss ab. Dabei analysieren sie bereits vorhandene Prozessdaten mit einem vorgegebenen Auswertungsverfahren. Sie planen mögliche technische Lösungen zur Digitalisierung des Prozesses und wählen auch unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten eine Umsetzungsvariante aus. Die Schülerinnen und Schüler implementieren die gewählte Lösung für den digitalisierten Prozess und dokumentieren diese, auch fremdsprachlich, für die Kunden. Sie begleiten die Kunden bei der Prozesstransformation, bewerten gemeinsam mit ihnen das Ergebnis und passen die Prozessdarstellung an. Sie reflektieren die Prozessgestaltung hinsichtlich ökonomischer und ökologischer Aspekte. |
||
| Lernfeld 12c: | Kundenspezifische Prozess- und Datenanalyse durchführen |
3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 120 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, einen Kundenauftrag zur
Prozess- und Datenanalyse vollständig durchzuführen und zu bewerten.
Die Schülerinnen und Schüler führen in Zusammenarbeit mit den Kunden eine Anforderungsanalyse durch und leiten daraus Projektziele, Anforderungen, gewünschte Ergebnisse, Schulungsbedarfe und Rahmenbedingungen ab. Auf dieser Basis planen und kalkulieren sie ein Projekt mit den dazugehörigen personellen und technischen Ressourcen. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Lösungsvarianten, vergleichen diese anhand festgelegter Kriterien sowie unter Berücksichtigung von Datenschutz und Datensicherheit. Sie wählen mit den Kunden die beste Lösung aus. Für den vereinbarten Auftrag erstellen sie ein Dokument über die zu erbringenden Leistungen und ein Angebot. Die Schülerinnen und Schüler implementieren die gewünschte Lösung. Dabei nutzen sie Maßnahmen zur Qualitätssicherung. Sie präsentieren den Kunden das Projektergebnis und führen eine Schulung durch. Sie übergeben den Kunden das Produkt sowie die Dokumentation. Die Schülerinnen und Schüler bewerten das Projektergebnis auch hinsichtlich Zielerreichung, Wirtschaftlichkeit, Skalierbarkeit und Verlässlichkeit. Sie reflektieren die Projektdurchführung und das Projektergebnis auch unter Berücksichtigung der kritisch-konstruktiven Kundenrückmeldungen. |
||
Fachinformatiker und Fachinformatikerin in der Fachrichtung Digitale Vernetzung
| Lernfeld 10d: | Cyber-physische Systeme entwickeln |
3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, cyber-physische Systeme
zu entwickeln, Sensoren und Aktoren zu integrieren sowie Software und Schnittstellen
zu implementieren.
Die Schülerinnen und Schüler analysieren einen Kundenauftrag zur Entwicklung eines cyber-physischen Systems. Sie informieren sich über Interaktionsmöglichkeiten zwischen Mensch, Maschine und künstlicher Intelligenz. Sie wählen eine Umsetzungsvariante für die Realisierung des Kundenauftrags aus. Die Schülerinnen und Schüler planen das cyber-physische System. Sie stimmen Komponenten, Vernetzung, Programmierung und Interaktionen aufeinander ab. Dabei prüfen sie auch den Einsatz von internen und externen Netzwerken und Diensten. Sie vernetzen die Komponenten, programmieren und konfigurieren Schnittstellen zur Datenübertragung und Visualisierung. Die Schülerinnen und Schüler realisieren die Interaktion zwischen Mensch, Maschine und künstlicher Intelligenz in dem cyber-physischen System. Dabei entwickeln sie Testkonzepte zur Überprüfung und Gewährleistung der Funktion des Gesamtsystems und wenden diese an. Sie erstellen technische Dokumentationen, auch multimedial, zur Bedienung und Wartung des Systems und übergeben diese an die Kunden. Sie bewerten in Kommunikation mit den Kunden das cyber-physische System auch hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Skalierbarkeit und Verlässlichkeit. Die Schülerinnen und Schüler reflektieren die Interaktion zwischen Mensch, Maschine und künstlicher Intelligenz und diskutieren auch ethisch-moralische Aspekte des Einsatzes von künstlicher Intelligenz. |
||
| Lernfeld 11d: | Betrieb und Sicherheit vernetzter Systeme gewährleisten |
3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, mit Hilfe einer Risikoanalyse
den Schutzbedarf eines vernetzten Systems zu ermitteln und Schutzmaßnahmen zu planen,
umzusetzen und zu dokumentieren.
Die Schülerinnen und Schüler bereiten sich auf ein Kundengespräch zur Identifizierung eines Schutzbedarfes vor. Hierzu informieren sie sich über Informationssicherheit in vernetzten Systemen. Sie ermitteln im Kundengespräch die Schutzziele, analysieren die Systeme hinsichtlich der Anforderungen an die Informationssicherheit und benennen Risiken. Die Schülerinnen und Schüler planen unter Beachtung betrieblicher IT-Sicherheitsleitlinien und rechtlicher Regelungen die Vorkehrungen und Maßnahmen zur Minimierung der Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts. Sie implementieren die Maßnahmen unter Berücksichtigung technischer und organisatorischer Rahmenbedingungen. Sie prüfen die Sicherheit des vernetzten Systems und bewerten das erreichte Sicherheitsniveau in Bezug auf die Kundenanforderungen, eingesetzter Maßnahmen und Wirtschaftlichkeit. Sie erstellen eine Dokumentation und informieren die Kunden über die Ergebnisse der Risikoanalyse. Die Schülerinnen und Schüler reflektieren den Arbeitsprozess hinsichtlich möglicher Optimierungen und diskutieren das Ergebnis in Bezug auf den Begriff der relativen Sicherheit des vernetzten Systems. |
||
| Lernfeld 12d: | Kundenspezifisches cyber-physisches System optimieren |
3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 120 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, einen Kundenauftrag zur
Optimierung eines cyber-physischen Systems vollständig durchzuführen und zu bewerten.
Die Schülerinnen und Schüler führen in Zusammenarbeit mit den Kunden eine Anforderungsanalyse durch und leiten daraus Projektziele, Anforderungen, gewünschte Ergebnisse, Schulungsbedarfe und Rahmenbedingungen ab. Auf dieser Basis planen und kalkulieren sie ein Projekt mit den dazugehörigen personellen und technischen Ressourcen. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Lösungsvarianten, vergleichen diese anhand festgelegter Kriterien sowie unter Berücksichtigung von Datenschutz und Datensicherheit. Sie wählen mit den Kunden die beste Lösung aus. Für den vereinbarten Auftrag erstellen sie ein Dokument über die zu erbringenden Leistungen und ein Angebot. Die Schülerinnen und Schüler implementieren die gewünschte Lösung. Dabei nutzen sie Maßnahmen zur Qualitätssicherung. Sie präsentieren den Kunden das Projektergebnis und führen eine Schulung durch. Sie übergeben den Kunden das Produkt sowie die Dokumentation. Die Schülerinnen und Schüler bewerten das Projektergebnis auch hinsichtlich Zielerreichung, Wirtschaftlichkeit, Skalierbarkeit und Verlässlichkeit. Sie reflektieren die Projektdurchführung und das Projektergebnis auch unter Berücksichtigung der kritisch-konstruktiven Kundenrückmeldungen. |
||
IT-System-Elektroniker und IT-System-Elektronikerin
|
Lernfeld 10:
(SE) |
Energieversorgung bereitstellen und Betriebssicherheit gewährleisten |
3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, eine gesicherte und redundante
Energieversorgung eines IT-Systems unter Berücksichtigung der Betriebssicherheit,
typischer Netzsysteme und erforderlicher Schutzmaßnahmen zu planen, zu realisieren
und zu dokumentieren.
Sie analysieren die Anforderungen der Kunden auch unter Beachtung der Skalierbarkeit und vergleichen diese mit dem vorhandenen Energieversorgungssystem auch anhand der technischen Dokumentation. Die Schülerinnen und Schüler planen die Abläufe für die elektrische Inbetriebnahme des IT-Systems. Dabei dimensionieren sie die elektrische Anlage und berücksichtigen die elektromagnetische Verträglichkeit. Sie legen die Vorgehensweise zur Auftragserfüllung, Materialdisposition und Abstimmung mit anderen Beteiligten fest. Sie wählen die Arbeitsmittel aus und stimmen den Arbeitsablauf mit den Kunden ab. Bei der Installation halten die Schülerinnen und Schüler die Sicherheitsregeln unter Berücksichtigung der Unfallverhütungsvorschriften beim Arbeiten in und an elektrischen Anlagen ein. Sie achten auf mögliche Gefahren des elektrischen Stromes und wenden Schutzmaßnahmen an. Die Schülerinnen und Schüler ergreifen Maßnahmen zur Sicherung der Energieversorgung beim kurzzeitigen Ausfall der regulären Stromversorgung (Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Notstromversorgung). Sie erstellen eine technische Dokumentation und unterweisen die Kunden im Umgang mit der Energieversorgungsanlage. Sie reflektieren mit den Kunden die erzielte Betriebssicherheit und beraten ihn bezüglich zusätzlicher vorbeugender Maßnahmen. |
||
|
Lernfeld 11:
(SE) |
Betrieb und Sicherheit vernetzter Systeme gewährleisten |
3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, mit Hilfe einer Risikoanalyse
den Schutzbedarf eines vernetzten Systems zu ermitteln und Schutzmaßnahmen zu planen,
umzusetzen und zu dokumentieren.
Die Schülerinnen und Schüler bereiten sich auf ein Kundengespräch zur Identifizierung eines Schutzbedarfes vor. Hierzu informieren sie sich über Informationssicherheit in vernetzten Systemen. Sie ermitteln im Kundengespräch die Schutzziele, analysieren die Systeme hinsichtlich der Anforderungen an die Informationssicherheit und benennen Risiken. Die Schülerinnen und Schüler planen unter Beachtung betrieblicher IT-Sicherheitsleitlinien und rechtlicher Regelungen die Vorkehrungen und Maßnahmen zur Minimierung der Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts. Sie implementieren die Maßnahmen unter Berücksichtigung technischer und organisatorischer Rahmenbedingungen. Sie prüfen die Sicherheit des vernetzten Systems und bewerten das erreichte Sicherheitsniveau in Bezug auf die Kundenanforderungen, eingesetzter Maßnahmen und Wirtschaftlichkeit. Sie erstellen eine Dokumentation und informieren die Kunden über die Ergebnisse der Risikoanalyse. Die Schülerinnen und Schüler reflektieren den Arbeitsprozess hinsichtlich möglicher Optimierungen und diskutieren das Ergebnis in Bezug auf den Begriff der relativen Sicherheit des vernetzten Systems. |
||
|
Lernfeld 12:
(SE) |
Instandhaltung planen und durchführen |
3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 120 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, für vernetzte IT-Systeme
eine Instandhaltung zu planen und durchzuführen sowie Maßnahmen zur Gewährleistung
der Betriebssicherheit umzusetzen.
Die Schülerinnen und Schüler führen in Zusammenarbeit mit den Kunden eine Anforderungsanalyse durch und leiten daraus Projektziele, Anforderungen, gewünschte Ergebnisse, Schulungsbedarfe und Rahmenbedingungen ab. Auf dieser Basis planen und kalkulieren sie ein Projekt mit den dazugehörigen personellen und technischen Ressourcen. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Lösungsvarianten, vergleichen diese anhand festgelegter Kriterien sowie unter Berücksichtigung von Datenschutz und Datensicherheit. Sie wählen mit den Kunden die beste Lösung aus. Für den vereinbarten Auftrag erstellen sie ein Dokument über die zu erbringenden Leistungen und ein Angebot. Die Schülerinnen und Schüler implementieren die gewünschte Lösung. Dabei nutzen sie Maßnahmen zur Qualitätssicherung. Sie präsentieren den Kunden das Projektergebnis und führen eine Schulung durch. Sie übergeben den Kunden das Produkt sowie die Dokumentation. Die Schülerinnen und Schüler bewerten das Projektergebnis auch hinsichtlich Zielerreichung, Wirtschaftlichkeit, Skalierbarkeit und Betriebssicherheit. Sie reflektieren die Projektdurchführung und das Projektergebnis auch unter Berücksichtigung der kritisch-konstruktiven Kundenrückmeldungen. |
||
Lesehinweise
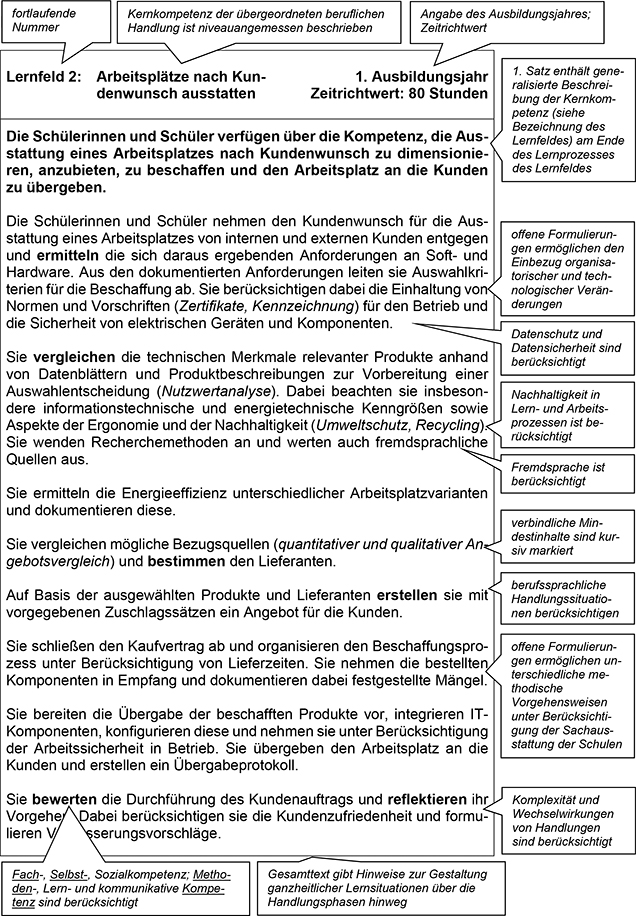
Rahmenlehrplan
für die Ausbildungsberufe
Kaufmann für IT-System-Management und
Kauffrau für IT-System-Management
Kaufmann für Digitalisierungsmanagement und
Kauffrau für Digitalisierungsmanagement
(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 13. Dezember 2019)
Vorbemerkungen
Dieser Rahmenlehrplan für den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule ist durch die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder beschlossen worden und mit der entsprechenden Ausbildungsordnung des Bundes (erlassen vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie oder dem sonst zuständigen Fachministerium im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung) abgestimmt.
Der Rahmenlehrplan baut grundsätzlich auf dem Niveau des Hauptschulabschlusses bzw. vergleichbarer Abschlüsse auf. Er enthält keine methodischen Festlegungen für den Unterricht. Der Rahmenlehrplan beschreibt berufsbezogene Mindestanforderungen im Hinblick auf die zu erwerbenden Abschlüsse.
Die Ausbildungsordnung des Bundes und der Rahmenlehrplan der Kultusministerkonferenz sowie die Lehrpläne der Länder für den berufsübergreifenden Lernbereich regeln die Ziele und Inhalte der Berufsausbildung. Auf diesen Grundlagen erwerben die Schülerinnen und Schüler den Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf sowie den Abschluss der Berufsschule.
Die Länder übernehmen den Rahmenlehrplan unmittelbar oder setzen ihn in eigene Lehrpläne um. Im zweiten Fall achten sie darauf, dass die Vorgaben des Rahmenlehrplanes zur fachlichen und zeitlichen Abstimmung mit der jeweiligen Ausbildungsordnung erhalten bleiben.
Bildungsauftrag der Berufsschule
Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen in der dualen Berufsausbildung einen gemeinsamen Bildungsauftrag.
Die Berufsschule ist dabei ein eigenständiger Lernort, der auf der Grundlage der Rahmenvereinbarung über die Berufsschule (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 12. März 2015 in der jeweils geltenden Fassung) agiert. Sie arbeitet als gleichberechtigter Partner mit den anderen an der Berufsausbildung Beteiligten zusammen und hat die Aufgabe, den Schülern und Schülerinnen die Stärkung berufsbezogener und berufsübergreifender Handlungskompetenz zu ermöglichen. Damit werden die Schülerinnen und Schüler zur Erfüllung der Aufgaben im Beruf sowie zur nachhaltigen Mitgestaltung der Arbeitswelt und der Gesellschaft in sozialer, ökonomischer, ökologischer und individueller Verantwortung, insbesondere vor dem Hintergrund sich wandelnder Anforderungen, befähigt. Das schließt die Förderung der Kompetenzen der jungen Menschen
- –
-
zur persönlichen und strukturellen Reflexion,
- –
-
zum verantwortungsbewussten und eigenverantwortlichen Umgang mit zukunftsorientierten Technologien, digital vernetzten Medien sowie Daten- und Informationssystemen,
- –
-
in berufs- und fachsprachlichen Situationen adäquat zu handeln,
- –
-
zum lebensbegleitenden Lernen sowie zur beruflichen und individuellen Flexibilität zur Bewältigung der sich wandelnden Anforderungen in der Arbeitswelt und Gesellschaft,
- –
-
zur beruflichen Mobilität in Europa und einer globalisierten Welt
ein.
Der Unterricht der Berufsschule basiert auf den für jeden staatlich anerkannten Ausbildungsberuf bundeseinheitlich erlassenen Ordnungsmitteln. Darüber hinaus gelten die für die Berufsschule erlassenen Regelungen und Schulgesetze der Länder.
Um ihren Bildungsauftrag zu erfüllen, muss die Berufsschule ein differenziertes Bildungsangebot gewährleisten, das
- –
-
in didaktischen Planungen für das Schuljahr mit der betrieblichen Ausbildung abgestimmte handlungsorientierte Lernarrangements entwickelt,
- –
-
einen Unterricht mit entsprechender individueller Förderung vor dem Hintergrund unterschiedlicher Erfahrungen, Fähigkeiten und Begabungen aller Schülerinnen und Schüler ermöglicht,
- –
-
ein individuelles und selbstorganisiertes Lernen in der digitalen Welt fördert,
- –
-
eine Förderung der bildungs-, berufs- und fachsprachlichen Kompetenz berücksichtigt,
- –
-
eine nachhaltige Entwicklung der Arbeits- und Lebenswelt und eine selbstbestimmte Teilhabe an der Gesellschaft unterstützt,
- –
-
für Gesunderhaltung und Unfallgefahren sensibilisiert,
- –
-
einen Überblick über die Bildungs- und beruflichen Entwicklungsperspektiven einschließlich unternehmerischer Selbstständigkeit aufzeigt, um eine selbstverantwortliche Berufs- und Lebensplanung zu unterstützen,
- –
-
an den relevanten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Ergebnissen im Hinblick auf Kompetenzentwicklung und Kompetenzfeststellung ausgerichtet ist.
Zentrales Ziel von Berufsschule ist es, die Entwicklung umfassender Handlungskompetenz zu fördern. Handlungskompetenz wird verstanden als die Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten.
Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz.
Fachkompetenz
Bereitschaft und Fähigkeit, auf der Grundlage fachlichen Wissens und Könnens Aufgaben und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen und das Ergebnis zu beurteilen.
Selbstkompetenz2
Bereitschaft und Fähigkeit, als individuelle Persönlichkeit die Entwicklungschancen, Anforderungen und Einschränkungen in Familie, Beruf und öffentlichem Leben zu klären, zu durchdenken und zu beurteilen, eigene Begabungen zu entfalten sowie Lebenspläne zu fassen und fortzuentwickeln. Sie umfasst Eigenschaften wie Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein. Zu ihr gehören insbesondere auch die Entwicklung durchdachter Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte.
Sozialkompetenz
Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, Zuwendungen und Spannungen zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen. Hierzu gehört insbesondere auch die Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidarität.
Methodenkompetenz, kommunikative Kompetenz und Lernkompetenz sind immanenter Bestandteil von Fachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz.
Methodenkompetenz
Bereitschaft und Fähigkeit zu zielgerichtetem, planmäßigem Vorgehen bei der Bearbeitung von Aufgaben und Problemen (zum Beispiel bei der Planung der Arbeitsschritte).
Kommunikative Kompetenz
Bereitschaft und Fähigkeit, kommunikative Situationen zu verstehen und zu gestalten. Hierzu gehört es, eigene Absichten und Bedürfnisse sowie die der Partner wahrzunehmen, zu verstehen und darzustellen.
Lernkompetenz
Bereitschaft und Fähigkeit, Informationen über Sachverhalte und Zusammenhänge selbstständig und gemeinsam mit anderen zu verstehen, auszuwerten und in gedankliche Strukturen einzuordnen. Zur Lernkompetenz gehört insbesondere auch die Fähigkeit und Bereitschaft, im Beruf und über den Berufsbereich hinaus Lerntechniken und Lernstrategien zu entwickeln und diese für lebenslanges Lernen zu nutzen.
Didaktische Grundsätze
Um dem Bildungsauftrag der Berufsschule zu entsprechen werden die jungen Menschen zu selbstständigem Planen, Durchführen und Beurteilen von Arbeitsaufgaben im Rahmen ihrer Berufstätigkeit befähigt.
Lernen in der Berufsschule zielt auf die Entwicklung einer umfassenden Handlungskompetenz. Mit der didaktisch begründeten praktischen Umsetzung – zumindest aber der gedanklichen Durchdringung – aller Phasen einer beruflichen Handlung in Lernsituationen wird dabei Lernen in und aus der Arbeit vollzogen.
Handlungsorientierter Unterricht im Rahmen der Lernfeldkonzeption orientiert sich prioritär an handlungssystematischen Strukturen und stellt gegenüber vorrangig fachsystematischem Unterricht eine veränderte Perspektive dar. Nach lerntheoretischen und didaktischen Erkenntnissen sind bei der Planung und Umsetzung handlungsorientierten Unterrichts in Lernsituationen folgende Orientierungspunkte zu berücksichtigen:
- –
-
Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die Berufsausübung bedeutsam sind.
- –
-
Lernen vollzieht sich in vollständigen Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder zumindest gedanklich nachvollzogen.
- –
-
Handlungen fördern das ganzheitliche Erfassen der beruflichen Wirklichkeit in einer zunehmend globalisierten und digitalisierten Lebens- und Arbeitswelt (zum Beispiel ökonomische, ökologische, rechtliche, technische, sicherheitstechnische, berufs-, fach- und fremdsprachliche, soziale und ethische Aspekte).
- –
-
Handlungen greifen die Erfahrungen der Lernenden auf und reflektieren sie in Bezug auf ihre gesellschaftlichen Auswirkungen.
- –
-
Handlungen berücksichtigen auch soziale Prozesse, zum Beispiel die Interessenerklärung oder die Konfliktbewältigung, sowie unterschiedliche Perspektiven der Berufs- und Lebensplanung.
Berufsbezogene Vorbemerkungen
Der vorliegende Rahmenlehrplan für die Berufsausbildungen zum Kaufmann für IT-System-Management und zur Kauffrau für IT-System-Management sowie zum Kaufmann für Digitalisierungsmanagement und zur Kauffrau für Digitalisierungsmanagement ist mit der IT-System-Management-Kaufleute-Ausbildungsverordnung vom 28. Februar 2020 (BGBl. I S. 280) sowie der Digitalisierungsmanagement-Kaufleute-Ausbildungsverordnung vom 28. Februar 2020 (BGBl. I S. 290) abgestimmt.
Die Rahmenlehrpläne für die Ausbildungsberufe Informations- und Telekommunikationssystem-Kaufmann/Informations- und Telekommunikationssystem-Kauffrau (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 25. April 1997) sowie Informatikkaufmann/Informatikkauffrau (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 25. April 1997) werden durch den vorliegenden Rahmenlehrplan aufgehoben.
In Ergänzung des Berufsbildes (Bundesinstitut für Berufsbildung unter http://www.bibb.de) sind folgende Aspekte im Rahmen des Berufsschulunterrichtes bedeutsam:
Kaufleute für IT-System-Management und Kaufleute für Digitalisierungsmanagement sind sowohl in der IT-Branche als auch branchenübergreifend tätig. Sie werden in unterschiedlichen Unternehmensbereichen und Einsatzgebieten eingesetzt, in denen sie oftmals eine Vermittlerrolle zwischen kaufmännischen und technischen Ansprechpartnern einnehmen.
Typische berufliche Handlungsfelder der Kaufleute für IT-System-Management sind die Beschaffung, der Vertrieb und die Administration von IT-Systemen sowie die Betreuung ihrer Anwender. Aufbauend auf den für beide Berufe grundlegenden Kompetenzen liegt der Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit bei den Kaufleuten für Digitalisierungsmanagement in der Digitalisierung, Optimierung und Weiterentwicklung von Geschäftsprozessen und -modellen. Sie beschäftigen sich mit Daten und Prozessen aus einer ökonomisch-betriebswirtschaftlichen Perspektive und machen Informationen und Wissen verfügbar, um aus der zunehmenden Digitalisierung wirtschaftlichen Nutzen zu ziehen.
Die Lernfelder orientieren sich an den beruflichen Handlungsfeldern. Sie sind methodisch-didaktisch so umzusetzen, dass sie zu einer umfassenden beruflichen Handlungskompetenz führen. Diese umfasst insbesondere fundiertes Fachwissen, kommunikative Fähigkeiten, vernetztes und analytisches Denken, Eigeninitiative, Empathie und Teamfähigkeit. Angesichts der kurzen Innovationszyklen im Bereich der IT-Techniken und IT-Anwendungen benötigen IT-Kaufleute ein hohes Maß an Selbstorganisation und Lernkompetenz.
Die in den Lernfeldern formulierten Kompetenzen beschreiben den Qualifikationsstand am Ende des Lernprozesses und stellen den Mindestumfang dar. Inhalte sind in Kursivschrift nur dann aufgeführt, wenn die in den Zielformulierungen beschriebenen Kompetenzen konkretisiert oder eingeschränkt werden sollen. Die Lernfelder bauen spiralcurricular aufeinander auf.
Der Kompetenzerwerb im Kontext der digitalen Arbeits- und Geschäftsprozesse ist integrativer Bestandteil der Fachkompetenzen und entfaltet sich darüber hinaus in überfachlichen Kompetenzdimensionen. Die Nutzung von informationstechnischen Systemen (IT-Systemen) und der Einsatz von digitalen Medien sind wesentliche Bestandteile der Lernfelder und im Unterricht der IT-Berufe besonders ausgeprägt. Unter IT-Systemen wird im Weiteren jegliche Art elektronischer datenverarbeitender Systeme verstanden, die zur Bearbeitung von Aufgaben und zur Lösung von Problemen mit der hierfür benötigten Software, Hardware sowie zugehörigen Dienstleistungen eingesetzt werden können. Im Rahmenlehrplan wird darüber hinaus die Bezeichnung „Kunden“ für firmenintern sowie extern auftraggebende Personen oder Gruppen verwendet.
Der Erwerb von Fremdsprachenkompetenz ist integrierter Bestandteil der Lernfelder. Bei entsprechender Relevanz ist er in einzelnen Lernfeldern zusätzlich gesondert ausgewiesen.
In den Lernfeldern werden die Dimensionen der Nachhaltigkeit – Ökonomie, Ökologie und Soziales –, des wirtschaftlichen Denkens, der soziokulturellen Unterschiede und der selbstbestimmten Teilhabe an der Gesellschaft berücksichtigt. Bei den IT-Berufen liegt zudem ein besonderes Augenmerk auf ethische Implikationen, welche sich beim Einsatz von autonomen Systemen und im Umgang mit sensiblen Daten aus dem Data-Mining ergeben.
Berufsbezogene Lernsituationen, in denen die Branchenvielfalt und die unterschiedlichen Einsatzbereiche der kaufmännischen IT-Berufe Berücksichtigung finden, nehmen die zentrale Stellung in der Unterrichtsgestaltung ein. Kaufleute in den IT-Berufen arbeiten in der Regel projekt- und teamorientiert, sodass dem Aufbau entsprechender Kompetenzen und dem Einsatz unterstützender Instrumente ein großer Stellenwert zukommt.
Den kaufmännischen IT-Berufen liegt eine gemeinsame Basis berufsübergreifender Kompetenzen mit den technischen IT-Berufen (Fachinformatiker und Fachinformatikerin, IT-System-Elektroniker und IT-System-Elektronikerin) zugrunde. Deshalb besteht die Möglichkeit einer gemeinsamen Beschulung im ersten Ausbildungsjahr der IT-Berufe, da die Lernfelder 1 bis 5 in den jeweiligen Rahmenlehrplänen identisch formuliert sind. Im zweiten Ausbildungsjahr trifft dies auch für das Lernfeld 6 zu.
Zudem sind bei den Kaufleuten für Digitalisierungsmanagement und Kaufleuten für IT-System-Management die Lernfelder 7 bis 9 auf den gleichen Kompetenzen aufgebaut. Im Falle einer gemeinsamen Beschulung sollten die jeweiligen berufstypischen Anforderungen durch Binnendifferenzierung berücksichtigt werden.
Aufgrund ihrer Prüfungsrelevanz sind die Lernfelder 1 bis 6 des Rahmenlehrplans vor Teil 1 der Abschlussprüfung zu unterrichten.
Lernfelder
|
Übersicht über die Lernfelder für die Ausbildungsberufe Kaufmann für IT-System-Management und Kauffrau für IT-System-Management Kaufmann für Digitalisierungsmanagement und Kauffrau für Digitalisierungsmanagement |
||||
|---|---|---|---|---|
| Lernfelder |
Zeitrichtwerte in Unterrichtsstunden |
|||
| Nr. | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | |
| 1 | Das Unternehmen und die eigene Rolle im Betrieb beschreiben | 40 | ||
| 2 | Arbeitsplätze nach Kundenwunsch ausstatten | 80 | ||
| 3 | Clients in Netzwerke einbinden | 80 | ||
| 4 | Schutzbedarfsanalyse im eigenen Arbeitsbereich durchführen | 40 | ||
| 5 | Software zur Verwaltung von Daten anpassen | 80 | ||
| 6 | Serviceanfragen bearbeiten | 40 | ||
| 7 | Softwareprojekte durchführen | 80 | ||
| 8 | Beschaffungsprozesse durchführen | 80 | ||
| 9 | Netzwerkbasierte IT-Lösungen umsetzen | 80 | ||
| Kaufmann für IT-System-Management und Kauffrau für IT-System-Management | ||||
| 10 (SM) |
Wertschöpfungsprozesse erfolgsorientiert steuern | 40 | ||
| 11 (SM) |
Absatzmarketing-Maßnahmen planen und bewerten | 40 | ||
| 12 (SM) |
Absatzprozesse durchführen und überwachen | 80 | ||
| 13 (SM) |
Netzwerkinfrastruktur planen und kalkulieren | 120 | ||
| Summen: insgesamt 880 Stunden | 320 | 280 | 280 | |
| Kaufmann für Digitalisierungsmanagement und Kauffrau für Digitalisierungsmanagement | ||||
| 10 (DM) |
Wertschöpfungsprozesse erfolgsorientiert steuern und preispolitische Maßnahmen ableiten | 80 | ||
| 11 (DM) |
Informationen und Daten aufbereiten | 80 | ||
| 12 (DM) |
Unternehmen digital weiterentwickeln | 120 | ||
| Summen: insgesamt 880 Stunden | 320 | 280 | 280 | |
| Lernfeld 1: | Das Unternehmen und die eigene Rolle im Betrieb beschreiben |
1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 40 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, ihr Unternehmen hinsichtlich
seiner Wertschöpfungskette zu präsentieren und ihre eigene Rolle im Betrieb zu beschreiben.
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich, auch anhand des Unternehmensleitbildes, über die ökonomischen, ökologischen und sozialen Zielsetzungen des Unternehmens. Sie analysieren die Marktstruktur in ihrer Branche und ordnen das Unternehmen als komplexes System mit seinen Markt- und Kundenbeziehungen ein. Sie beschreiben die Wertschöpfungskette und ihre eigene Rolle im Betrieb. Dabei erkunden sie die Leistungsschwerpunkte sowie Besonderheiten ihres Unternehmens und setzen sich mit der Organisationsstruktur (Aufbauorganisation) und Rechtsform auseinander. Sie informieren sich über den eigenen Handlungs- und Entscheidungsspielraum im Unternehmen (Vollmachten) sowie über Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Sie planen und erstellen, auch im Team, adressatengerecht multimediale Darstellungen zu ihrem Unternehmen. Die Schülerinnen und Schüler präsentieren ihre Ergebnisse. Sie überprüfen kriteriengeleitet die Qualität ihres Handlungsproduktes und entwickeln gemeinsam Verbesserungsmöglichkeiten. Sie reflektieren die eigene Rolle und das eigene Handeln im Betrieb. |
||
| Lernfeld 2: | Arbeitsplätze nach Kundenwunsch ausstatten |
1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, die Ausstattung eines Arbeitsplatzes
nach Kundenwunsch zu dimensionieren, anzubieten, zu beschaffen und den Arbeitsplatz
an die Kunden zu übergeben.
Die Schülerinnen und Schüler nehmen den Kundenwunsch für die Ausstattung eines Arbeitsplatzes von internen und externen Kunden entgegen und ermitteln die sich daraus ergebenden Anforderungen an Soft- und Hardware. Aus den dokumentierten Anforderungen leiten sie Auswahlkriterien für die Beschaffung ab. Sie berücksichtigen dabei die Einhaltung von Normen und Vorschriften (Zertifikate, Kennzeichnung) für den Betrieb und die Sicherheit von elektrischen Geräten und Komponenten. Sie vergleichen die technischen Merkmale relevanter Produkte anhand von Datenblättern und Produktbeschreibungen zur Vorbereitung einer Auswahlentscheidung (Nutzwertanalyse). Dabei beachten sie insbesondere informationstechnische und energietechnische Kenngrößen sowie Aspekte der Ergonomie und der Nachhaltigkeit (Umweltschutz, Recycling). Sie wenden Recherchemethoden an und werten auch fremdsprachliche Quellen aus. Sie ermitteln die Energieeffizienz unterschiedlicher Arbeitsplatzvarianten und dokumentieren diese. Sie vergleichen mögliche Bezugsquellen (quantitativer und qualitativer Angebotsvergleich) und bestimmen den Lieferanten. Auf Basis der ausgewählten Produkte und Lieferanten erstellen sie mit vorgegebenen Zuschlagssätzen ein Angebot für die Kunden. Sie schließen den Kaufvertrag ab und organisieren den Beschaffungsprozess unter Berücksichtigung von Lieferzeiten. Sie nehmen die bestellten Komponenten in Empfang und dokumentieren dabei festgestellte Mängel. Sie bereiten die Übergabe der beschafften Produkte vor, integrieren IT-Komponenten, konfigurieren diese und nehmen sie unter Berücksichtigung der Arbeitssicherheit in Betrieb. Sie übergeben den Arbeitsplatz an die Kunden und erstellen ein Übergabeprotokoll. Sie bewerten die Durchführung des Kundenauftrags und reflektieren ihr Vorgehen. Dabei berücksichtigen sie die Kundenzufriedenheit und formulieren Verbesserungsvorschläge. |
||
| Lernfeld 3: | Clients in Netzwerke einbinden |
1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, eine Netzwerkinfrastruktur
zu analysieren sowie Clients zu integrieren.
Die Schülerinnen und Schüler erfassen im Kundengespräch die Anforderungen an die Integration von Clients (Soft- und Hardware) in eine bestehende Netzwerkinfrastruktur und leiten Leistungskriterien ab. Sie informieren sich über Strukturen und Komponenten des Netzwerkes und erfassen deren Eigenschaften und Standards. Dazu verwenden sie technische Dokumente, auch in fremder Sprache. Sie nutzen physische sowie logische Netzwerkpläne und beachten betriebliche Sicherheitsvorgaben. Sie planen die Integration in die bestehende Netzwerkinfrastruktur indem sie ein anforderungsgerechtes Konzept auch unter ökologischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten (Energieeffizienz) erstellen. Sie führen auf der Basis der Leistungskriterien die Auswahl von Komponenten durch. Sie konfigurieren Clients und binden diese in das Netzwerk ein. Sie prüfen systematisch die Funktion der konfigurierten Clients im Netzwerk und protokollieren das Ergebnis. Sie reflektieren den Arbeitsprozess hinsichtlich möglicher Optimierungen und diskutieren das Ergebnis in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Ökologie. |
||
| Lernfeld 4: | Schutzbedarfsanalyse im eigenen Arbeitsbereich durchführen |
1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 40 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, mit Hilfe einer bestehenden
Sicherheitsleitlinie eine Schutzbedarfsanalyse zur Ermittlung der Informationssicherheit
auf Grundschutzniveau in ihrem Arbeitsbereich durchzuführen.
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über Informationssicherheit (Schutzziele) und rechtliche Regelungen sowie die Einhaltung von betrieblichen Vorgaben zur Bestimmung des Schutzniveaus für den eigenen Arbeitsbereich. Sie planen eine Schutzbedarfsanalyse, indem sie gemäß der IT-Sicherheitsleitlinie des Unternehmens Schutzziele des Grundschutzes (Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit) in ihrem Arbeitsbereich ermitteln und eine Klassifikation von Schadensszenarien vornehmen. Sie entscheiden über die Gewichtung möglicher Bedrohungen unter Berücksichtigung der Schadensszenarien. Dazu führen sie eine Schutzbedarfsanalyse in ihrem Arbeitsbereich durch, nehmen Bedrohungsfaktoren auf und dokumentieren diese. Die Schülerinnen und Schüler bewerten die Ergebnisse der Schutzbedarfsanalyse und gleichen diese mit der IT-Sicherheitsleitlinie des Unternehmens ab. Sie empfehlen Maßnahmen und setzen diese im eigenen Verantwortungsbereich um. Sie reflektieren den Arbeitsablauf und übernehmen Verantwortung im IT-Sicherheitsprozess. |
||
| Lernfeld 5: | Software zur Verwaltung von Daten anpassen |
1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Informationen mittels Daten
abzubilden, diese Daten zu verwalten und dazu Software anzupassen.
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich innerhalb eines Projektes über die Abbildung von Informationen mittels Daten. Dabei analysieren sie Daten hinsichtlich Herkunft, Art, Verfügbarkeit, Datenschutz, Datensicherheit und Speicheranforderung und berücksichtigen Datenformate und Speicherlösungen. Sie planen die Anpassung einer Anwendung zur Verwaltung der Datenbestände und entwickeln Testfälle. Dabei entscheiden sie sich für ein Vorgehen. Die Schülerinnen und Schüler implementieren die Anpassung der Anwendung, auch im Team und erstellen eine Softwaredokumentation. Sie testen die Funktion der Anwendung und beurteilen deren Eignung zur Bewältigung der gestellten Anforderungen. Sie evaluieren den Prozess der Softwareentwicklung. |
||
| Lernfeld 6: | Serviceanfragen bearbeiten |
2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 40 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Serviceanfragen einzuordnen,
Fehlerursachen zu ermitteln und zu beheben.
Die Schülerinnen und Schüler nehmen Serviceanfragen entgegen (direkter und indirekter Kundenkontakt). Sie analysieren Serviceanfragen und prüfen deren vertragliche Grundlage (Service-Level-Agreement). Sie ermitteln die Reaktionszeit und dokumentieren den Status der Anfragen im zugrunde liegenden Service-Management-System. Durch systematisches Fragen ordnen die Schülerinnen und Schüler Serviceanfragen unter Berücksichtigung des Support-Levels und fachlicher Standards ein. Sie ermitteln Lösungsmöglichkeiten im Rahmen des Support-Levels. Auf dieser Basis bearbeiten sie das Problem und dokumentieren den Bearbeitungsstatus. Sie kommunizieren mit den Prozessbeteiligten situationsgerecht, auch in einer Fremdsprache, und passen sich den unterschiedlichen Kommunikationsanforderungen an (Kommunikationsmodelle, Deeskalationsstrategien). Sie reflektieren den Bearbeitungsprozess der Serviceanfragen und ihr Verhalten in Gesprächssituationen. Die Schülerinnen und Schüler diskutieren die Servicefälle und schlagen Maßnahmen zur Qualitätssteigerung vor. |
||
| Lernfeld 7: | Softwareprojekte durchführen |
2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Software zu entwerfen, zu
implementieren und zu testen.
Die Schülerinnen und Schüler erfassen die Zielsetzung des Kundenauftrags und leiten daraus Anforderungen für eine anzupassende Software ab. Sie analysieren relevante Schnittstellen, Prozesse und Datenbestände bei den Kunden. Sie informieren sich auf Basis eines gegebenen Vorgehensmodells über ihre Rolle im Softwareprojekt. Anhand von Projektunterlagen planen und strukturieren sie den Projektablauf eigenverantwortlich, erfassen den Aufwand für das Projekt und schätzen mögliche Risiken ein. Sie entwerfen und implementieren Datenstrukturen, Algorithmen und Benutzerschnittstellen (Softwareergonomie) zur Umsetzung des Kundenauftrags. Mithilfe von Visualisierungstechniken dokumentieren sie für die Kunden und das Projektteam den Stand des Softwareentwurfs. Sie übernehmen Verantwortung im Team, halten sich an Vereinbarungen und kommunizieren unter Einsatz von Fachsprache situationsangemessen. Die Schülerrinnen und Schüler testen ihre Software systematisch und korrigieren Fehler. Sie reflektieren den Projektablauf sowie den Einsatz des verwendeten Programmierparadigmas und des angewandten Vorgehensmodells. Sie wägen den Einsatz von Standard- und Individuallösungen unter Aspekten der Wirtschaftlichkeit ab. |
||
| Lernfeld 8: | Beschaffungsprozesse durchführen |
2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Beschaffungsprozesse durchzuführen
und zu überwachen sowie die zugrunde liegenden Wertströme zu analysieren.
Ausgehend von vorliegenden Angeboten zu Hard- und Software sowie Dienstleistungen informieren sich die Schülerinnen und Schüler über verschiedene Vertragsarten (Kaufvertrag, Mietvertrag, Leasingvertrag, Kreditvertrag, Werkvertrag, Werklieferungsvertrag, Dienstvertrag). Dabei beachten sie rechtliche Regelungen und deren Wirkung (Besitz, Eigentum, Nichtigkeit, Anfechtung) sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sie entscheiden sich für ein Angebot und lösen die Beschaffung aus. Sie überwachen und prüfen den Wareneingang und nehmen Dienstleistungen ab. Sie identifizieren rechtliche und ökonomische Handlungsspielräume innerhalb der betrieblichen Vorgaben bei Vertragsstörungen (Nicht-Rechtzeitig-Lieferung, Schlechtleistung) und entwickeln, auch im Team, geeignete Lösungsvorschläge. Die Schülerinnen und Schüler analysieren Wertströme ihres Unternehmens anhand von Belegen im Beschaffungsprozess. Sie untersuchen deren Auswirkungen auf das Vermögen und Kapital sowie den Erfolg des Unternehmens. Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren Eingangsrechnungen, berücksichtigen die Umsatzsteuer und veranlassen die situationsgerechte Bezahlung (Skontonutzung). Sie interpretieren die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und die Auswirkungen auf den Erfolg ihres Unternehmens. Sie dokumentieren den gesamten Beschaffungsprozess softwaregestützt (integrierte Unternehmenssoftware). Die Schülerinnen und Schüler beurteilen den Beschaffungsprozess und zeigen begründet Möglichkeiten der Optimierung auf. Sie reflektieren ihre Mitverantwortung für Menschen und Umwelt im Zusammenhang mit dem Beschaffungsprozess. |
||
| Lernfeld 9: | Netzwerkbasierte IT-Lösungen umsetzen |
2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, netzwerkbasierte IT-Lösungen
anforderungsgerecht zu planen, einzurichten und zu dokumentieren.
Die Schülerinnen und Schüler ermitteln im Gespräch mit den Kunden und auf Basis der Analyse visualisierter Geschäftsprozesse Anforderungen an eine netzwerkbasierte IT-Lösung. Sie erfassen den Ist-Zustand der vorhandenen IT-Lösung. Die Schülerinnen und Schüler planen eine netzwerkbasierte IT-Lösung und stellen die erforderlichen Netzwerkdienste fest. Sie leiten ein Benutzer- und Zugriffskonzept ab und berücksichtigen dabei Maßnahmen des Datenschutzes und der Datensicherheit. Sie stimmen das Konzept mit den Kunden ab und beraten ihn hinsichtlich der Softwarelizenzierung und weiterer Dienstleistungsangebote. Sie setzen ihre geplante netzwerkbasierte IT-Lösung um und kontrollieren diese hinsichtlich der Vorgaben der Kunden. Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren den neuen Ist-Zustand. Sie konzipieren eine Mitarbeiterschulung, führen diese durch und reflektieren das Feedback der Schulungsteilnehmenden. |
||
Kaufmann für IT-System-Management und Kauffrau für IT-System-Management
|
Lernfeld 10: (SM) |
Wertschöpfungsprozesse erfolgsorientiert steuern |
3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 40 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, die betriebliche Kosten-
und Leistungsrechnung durchzuführen und mit Hilfe der Ergebnisse zur Steuerung des
Unternehmens beizutragen.
Die Schülerinnen und Schüler analysieren die Erfolgssituation des Unternehmens. Dazu informieren sie sich über Kostenarten und Leistungen. Sie identifizieren Kostenstellen und Kostenträger. Die Schülerinnen und Schüler grenzen im Rahmen der Vollkostenrechnung Kosten und Leistungen von Aufwendungen und Erträgen ab. Sie erstellen einen einstufigen Betriebsabrechnungsbogen und ermitteln Zuschlagssätze für die Kostenstellen. Diese nutzen sie in der Kostenträgerrechnung zur Kalkulation von Angebotspreisen (Vorwärts- und Differenzkalkulation, Handelsspanne). Sie beurteilen die Ergebnisse der Nachkalkulation und leiten mögliche Ursachen für Abweichungen ab. Die Schülerinnen und Schüler führen im Rahmen der Teilkostenrechnung eine kurzfristige Erfolgsrechnung (Deckungsbeiträge I, Betriebsergebnis, Gewinnschwelle, Preisuntergrenze) für einzelne Produktkategorien durch. Sie beurteilen die Ergebnisse unter Nutzung von branchenüblichen Kennzahlen, auch im Zeitvergleich. Sie entwickeln unter der Berücksichtigung der Nachhaltigkeit Vorschläge zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation und zur Steuerung des Unternehmens. |
||
|
Lernfeld 11: (SM) |
Absatzmarketing-Maßnahmen planen und bewerten |
3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 40 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Absatzmarketing-Maßnahmen
zu planen und deren Erfolg zu bewerten.
Die Schülerinnen und Schüler analysieren auftragsbezogen Zielgruppen und informieren sich über aktuelle Marketing-Maßnahmen des Unternehmens und der Wettbewerber (Benchmarking). Sie planen ergänzende Absatzmarketing-Maßnahmen zur Kundengewinnung, Bestandskundenbindung und Kundenreaktivierung. Dazu verwenden sie Instrumente der Marktbeobachtung und -analyse. Sie halten rechtliche Regelungen und betriebliche Vorgaben ein und berücksichtigen ethische Grenzen sowie interkulturelle Besonderheiten. Die Schülerinnen und Schüler präsentieren das Planungsergebnis den Auftraggebern und vertreten ihre Entscheidungen. Sie evaluieren den Erfolg bereits durchgeführter Maßnahmen und reflektieren die strategische Position des Unternehmens im Vergleich zu den Mitbewerbern. |
||
|
Lernfeld 12: (SM) |
Absatzprozesse durchführen und überwachen |
3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Absatzprozesse zu planen,
durchzuführen und zu überwachen.
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über Möglichkeiten des After-Sales-Marketings und beraten Kunden zu einem vorliegenden Angebot. Sie bereiten für die Kunden einen Vertrag unterschriftsreif vor und beachten rechtliche Regelungen sowie deren Wirkung. Dabei berücksichtigen sie Maßnahmen zur Absicherung der entstehenden Forderungen. Nach Vertragsabschluss überwachen sie den Prozess der Leistungserstellung und veranlassen die Rechnungsstellung. Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren die Zahlungsvorgänge. Sie interpretieren die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und die Auswirkungen auf den Erfolg ihres Unternehmens. Sie identifizieren rechtliche und ökonomische Handlungsspielräume innerhalb betrieblicher Vorgaben bei Vertragsstörungen (Nicht-Rechtzeitig-Zahlung, Nicht-Rechtzeitige-Annahme) und entwickeln, auch im Team, geeignete Lösungsvorschläge. Die Schülerinnen und Schüler analysieren Wertströme ihres Unternehmens anhand von Belegen im Absatzprozess. Sie untersuchen deren Auswirkungen auf das Vermögen und Kapital sowie den Erfolg des Unternehmens. Sie dokumentieren den gesamten Absatzprozess softwaregestützt (integrierte Unternehmenssoftware). Die Schülerinnen und Schüler beurteilen den Absatzprozess und zeigen begründet Möglichkeiten der Optimierung auf. Sie reflektieren den Beitrag aller an der Wertschöpfung Beteiligten, die Auswirkungen des Absatzprozesses auf die Kundenbeziehung und ihre Mitverantwortung in diesem Zusammenhang. |
||
|
Lernfeld 13: (SM) |
Netzwerkinfrastruktur planen und kalkulieren |
3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 120 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, eine Netzwerkinfrastruktur
projekt- und teambezogen zu planen sowie die Kosten zu kalkulieren.
Die Schülerinnen und Schüler ermitteln die Kundenanforderungen an eine Netzwerkinfrastruktur (kabelgebunden, kabellos). Dazu erstellen sie im Rahmen einer Anforderungsanalyse eine Anforderungsdefinition. Sie planen die Netzwerkinfrastruktur und erstellen physische und logische Netzwerkpläne zur Dokumentation. Sie wählen passive und aktive Komponenten aus und verwenden dazu technische Dokumente, auch in fremder Sprache. Die Schülerinnen und Schüler berücksichtigen Aspekte der IT-Sicherheit, einen sicheren Zugang zu öffentlichen Netzen sowie die sichere Verbindung von IT-Systemen über öffentliche Netze. Die Schülerinnen und Schüler planen die Umsetzung mit Instrumenten des Projektmanagements unter der Berücksichtigung von Qualitätssicherungsmaßnahmen. Sie antizipieren mögliche Widerstände und Projekthemmnisse. Die Schülerinnen und Schüler kalkulieren die Kosten. Sie präsentieren ihre Lösung adressatengerecht den Kunden und beantworten Nachfragen. Die Schülerinnen und Schüler bewerten ihre Lösung hinsichtlich Zielerreichung und Erweiterbarkeit. Sie reflektieren ihr Vorgehen und die Zusammenarbeit im Team. Sie entwickeln Vorschläge zur Optimierung. |
||
Kaufmann für Digitalisierungsmanagement und Kauffrau für Digitalisierungsmanagement
|
Lernfeld 10: (DM) |
Wertschöpfungsprozesse erfolgsorientiert steuern und preispolitische Maßnahmen ableiten |
3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, die betriebliche Kosten-
und Leistungsrechnung durchzuführen, preispolitische Maßnahmen abzuleiten und mit
Hilfe der Ergebnisse zur Steuerung des Unternehmens beizutragen.
Die Schülerinnen und Schüler analysieren die Erfolgssituation des Unternehmens. Dazu informieren sie sich über Kostenarten und Leistungen. Sie identifizieren Kostenstellen und Kostenträger. Die Schülerinnen und Schüler grenzen im Rahmen der Vollkostenrechnung Kosten und Leistungen von Aufwendungen und Erträgen ab. Sie erstellen einen einstufigen Betriebsabrechnungsbogen und ermitteln Zuschlagssätze für die Kostenstellen. Diese nutzen sie in der Kostenträgerrechnung zur Kalkulation von Angebotspreisen (Vorwärts- und Differenzkalkulation, Handelsspanne). Sie beurteilen die Ergebnisse der Nachkalkulation und leiten mögliche Ursachen für Abweichungen ab. Sie erläutern die Grenzen und Defizite des kostenstellenorientierten Vorgehens. Die Schülerinnen und Schüler berechnen Prozesskosten, indem sie Prozesse analysieren, Kosten zuordnen und Kostentreiber ermitteln. Die Schülerinnen und Schüler führen im Rahmen der Teilkostenrechnung eine kurzfristige Erfolgsrechnung (Deckungsbeiträge I, Betriebsergebnis, Gewinnschwelle, Preisuntergrenze) für einzelne Produktkategorien durch. Die Schülerinnen und Schüler führen eine Grenzkostenbetrachtung für digitale Geschäftsmodelle durch. Darauf aufbauend ermitteln sie Spielräume zur Preisgestaltung und Preisdifferenzierung am Markt, die sich am Kundennutzen orientieren. Sie beurteilen die Ergebnisse unter Nutzung von branchenüblichen Kennzahlen, auch im Zeitvergleich. Sie entwickeln unter der Berücksichtigung der Nachhaltigkeit Vorschläge zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation und zur Steuerung des Unternehmens. |
||
|
Lernfeld 11: (DM) |
Informationen und Daten aufbereiten |
3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Informationen und Daten
zu erfassen, zusammenzuführen, zu kategorisieren, zu filtern und sie so nutzbar zu
machen.
Die Schülerinnen und Schüler analysieren digitale, analoge sowie informelle Informationen und Daten und prüfen deren Qualität (Validität, Reliabilität, Vollständigkeit). Dazu nutzen sie interne und externe Quellen. Sie informieren sich über die Strukturen und Formate, in denen die Daten vorliegen, sowie über die Möglichkeiten, die Daten in andere Strukturen und Formate zu überführen. Die Schülerinnen und Schüler planen die Gewinnung, Aufbereitung und Visualisierung der Informationen und Daten. Dazu wägen sie unterschiedliche Techniken und Methoden ab, wählen das geeignete Vorgehen aus und dokumentieren dieses. Dabei beachten sie die gesetzlichen Regelungen und betriebliche Vorgaben des Datenschutzes sowie ethische Aspekte. Die Schülerinnen und Schüler bereiten Daten auf und übernehmen Verantwortung für die technische Realisierung im multiprofessionellen Team. In der Zusammenarbeit wählen und nutzen sie passende Notationen und Fachbegriffe, auch in einer fremden Sprache. Die Schülerinnen und Schüler beurteilen das Ergebnis im Hinblick auf die aktuelle und zukünftige Verwertbarkeit. Sie prüfen den Bedarf der Gewinnung weiterer Daten und der Durchführung weiterer Analysen. Sie reflektieren die Diskrepanz zwischen ökonomischen Interessen der Datennutzung und dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung. |
||
|
Lernfeld 12: (DM) |
Unternehmen digital weiterentwickeln |
3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 120 Stunden |
|
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, im Team Geschäftsmodell
und Geschäftsprozesse des Unternehmens zu analysieren und Vorschläge für eine marktgerechte
digitale Weiterentwicklung zu erarbeiten.
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über Geschäftsmodell und Vertriebswege des Unternehmens. Mithilfe der identifizierten Geschäftsprozesse beschreiben sie die Prozesslandschaft des Unternehmens. Sie ermitteln die Erwartungen der betrieblichen Prozessteilnehmer und der externen Marktteilnehmer. Sie wenden Methoden zur Informationsbeschaffung und Marktanalyse an und beschreiben vorhandenes Marktpotenzial. Die Schülerinnen und Schüler planen auftragsbezogen die Reorganisation bestehender Prozesse, die Ausgestaltung neuer Prozesse sowie die digitale Weiterentwicklung des Geschäftsmodells. Dazu visualisieren sie den Ist-Zustand und erfassen Änderungs- und Optimierungsbedarf, unter besonderer Beachtung der Daten. Sie nehmen Referenzprozesse sowie Beispiele für digitale Geschäftsmodelle zur Hilfe. Sie richten ihre Lösung konsequent am Nutzen der internen und externen Kunden aus und beachten Datenhoheit sowie Schutzrechte. Sie modellieren den Sollzustand, wenden Werkzeuge der Prozessanalyse an und überprüfen ihre Ideen auf Wirtschaftlichkeit und Machbarkeit. Dazu vergleichen sie Digitalisierungsgrad, Kosten und Wertschöpfung des Ist- mit dem angestrebten Sollzustand. Sie erarbeiten Vorschläge zur technischen Realisierung des angestrebten Sollzustandes und präsentieren ihr Ergebnis den Auftraggebern. Die Schülerinnen und Schüler reflektieren ihr Vorgehen und die Zusammenarbeit im Team sowie das erreichte Ergebnis aus verschiedenen Perspektiven. Sie beurteilen die strategische Position des Unternehmens auf dem Markt und prüfen die Notwendigkeit zur permanenten Anpassung der Prozesse und der Weiterentwicklung des Unternehmens. |
||
Lesehinweise
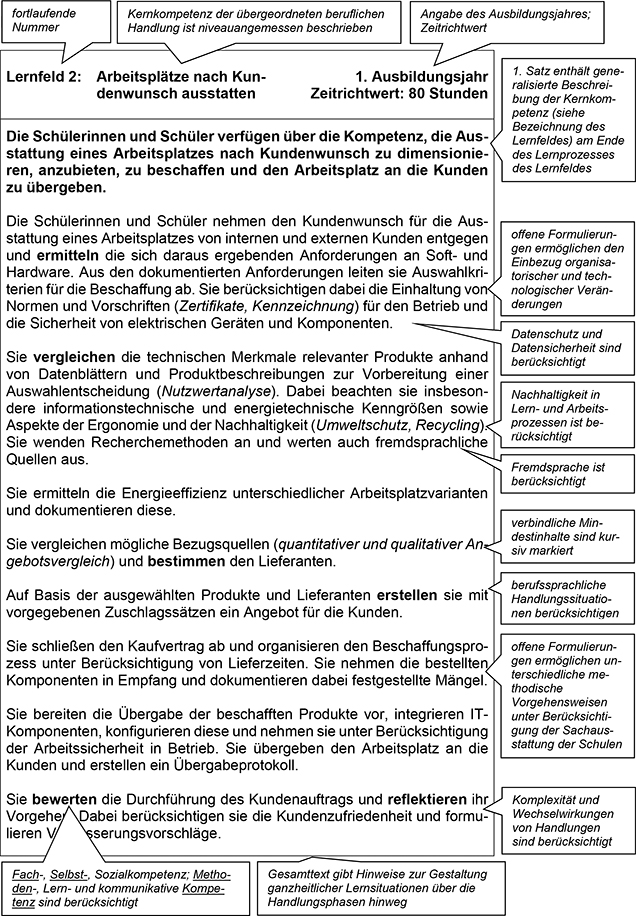
- *
- Verkündet am 5. März 2020 (BGBl. I S. 250)
- *
- Verkündet am 5. März 2020 (BGBl. I S. 268)
- *
- Verkündet am 5. März 2020 (BGBl. I S. 280)
- *
- Verkündet am 5. März 2020 (BGBl. I S. 290)
- 1
- Der Begriff „Selbstkompetenz“ ersetzt den bisher verwendeten Begriff „Humankompetenz“. Er berücksichtigt stärker den spezifischen Bildungsauftrag der Berufsschule und greift die Systematisierung des DQR auf.
- 2
- Der Begriff „Selbstkompetenz“ ersetzt den bisher verwendeten Begriff „Humankompetenz“. Er berücksichtigt stärker den spezifischen Bildungsauftrag der Berufsschule und greift die Systematisierung des DQR auf.

